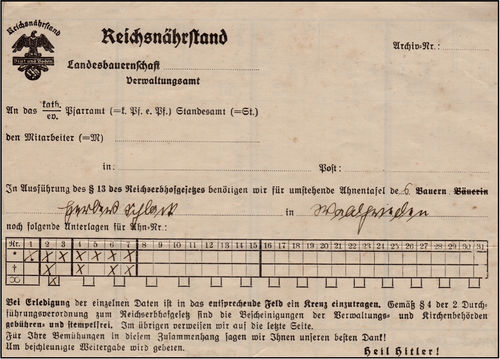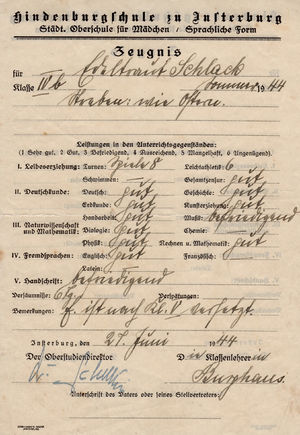Hof Brandstäter
Hof Brandstäter / Waldfrieden Kirchspiel Aulenbach ( Aulowönen ) |

|

Leben auf einem ostpreußischen Bauernhof
Der Bericht steht im ComGen Digisat zur Verfügung: Digitalisat in der DigiBib
Leben auf einem ostpreußischen Bauernhof
Waldfrieden / Krs. Insterburg
1930-1945
Edeltraut Tauchmann geb. Schlack
Bischweier
Februar 2021
© Arbeitsgemeinschaft Kirchspiel Aulenbach 2021 (info@kirchspiel-aulenbach.de)
Allgemeines
Wohn- und Nutzgebäude
Unser 48,34 ha großer Bauernhof lag ein beträchtliches Stück vom Dorf Waldfrieden_(Ostp.) entfernt, wir wohnten allein auf weiter Flur, umgeben von unserem eigenen Land und ohne direkte Nachbarn. Von der Landstraße führte ein mit Birken eingefasster Privatweg zu unserem Gehöft. Die Hauptgebäude standen wie bei allen Bauernhöfen im Geviert (4 Häuser) um einen freien Platz, den Hofplatz, kurz Hof genannt (die Bezeichnung „Hof“ bedeutete also sowohl Hofplatz als auch Gehöft/Bauernhof). Dem Wohnhaus gegenüber lag die Scheune, rechts und links die Ställe für Pferde, Kühe, Schweine und Federvieh. So konnte man vom Wohnhaus aus den ganzen Hof überblicken und die dortigen Vorgänge ggf. auch ungesehen kontrollieren.
Außerhalb des Hofkarrees befanden sich noch eine Schmiede und eine vielseitig genutzte Holz- und Wagenschauer. Diese diente sowohl als Lagerplatz für Brennmaterial wie Holz, Kohlen, Briketts und Grude/Grudekoks als auch als Unterstellplatz für Kutschwagen, Gig (ein einspänniger, zweirädriger offener Wagen mit Gabeldeichsel für ein Pferd zum Selbstfahren), Schlitten, Handwagen und dergleichen. Des weiteren gab es hier so etwas wie eine Tischler-Werkstatt, ausgestattet mit großer Werkbank, Hobelbank mit Schraubstock und einem Großangebot an Werkzeugen wie Hammer, Äxte, Sägen, Hobeln, Feilen, Raspeln, Stemmeisen, Schraubenzieher etc., so dass selbst der in Abständen einbestellte Stellmacher kaum eigenes Handwerkszeug mitzubringen hatte. Was für ein idealer Platz für uns Kinder, hier ohne Beaufsichtigung herumzuwerkeln!
Gewiss nicht ganz den Vorschriften entsprechend war das Auto in der zu einer Garage ausgebauten zwischen Scheune und Kuhstall gelegenen Remise (Unterstellplatz) untergebracht, in der sich auch der Trecker und diverse Ackergeräte befanden. Was nicht gerade Platz hatte, wurde wie auf anderen Höfen zwischenzeitlich im Freien abgestellt.
Auf der Fotokopie sieht man ein weiteres Gebäude, von uns Keller genannt. Das untere Stockwerk steckte nämlich tief in einem Erdaufwurf und war somit kühl und ideal für die Lagerung von Hackfrüchten wie Kartoffeln, Rüben, Wrucken (Steckrüben) und Rote Beten, aber auch Kohlsorten wie Weiß-, Rotkohl und Wirsing. Im vorderen Teil befand sich eine Futterküche (Vorbereitung des Tierfutters). Solche Keller gab es auch auf anderen Gehöften. Für gewöhnlich waren die einstöckig und mit Moos überwachsen. Der unsrige besaß ein Dachgeschoss (Kniestock), wo die Hühner und Puten ihr Reich hatten. Über eine verbreiterte, aber für Fuchs, Iltis und Marder unüberwindbare Sprossenleiter konnten sie nach Belieben ein- und ausgehen. Dieser alte Keller war kein Prachtstück, und so ließ ihn mein Stiefvater (Anm. mein leiblicher Vater war 1932 bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen) abreißen und durch je einen Anbau an Schweine- und Kuhstall ersetzen. Dadurch bekamen die Hühner und Puten zusammen mit den Gänsen und Enten einen ebenerdigen Stall, was zu unserem Schrecken eines der oben erwähnten Raubtiere mehrere Male zu nutzen wusste.
... ein weiteres Gebäude
Da ich mit Akribie jedes Gebäude aufgezählt habe, darf ich zwei nicht unterschlagen, obgleich ich dieses Kapitel gerne unerwähnt lassen würde. Es handelt sich um die beiden Plumpsklos, das eine für die Familie und Besucher, das andere für das Dienstpersonal. Diese hölzernen Herzhäuschen befanden sich bei der Holz- und Wagenschauer, also ein beträchtliches Stück vom Wohnhaus entfernt, wurden sie doch nicht als Vorzeigeobjekt angesehen. Bei Regen und Wind dorthin zu gehen, war nicht angenehm. Was für ein beschwerlicher Gang aber erst an dunklen, eiskalten Winterabenden, wenn man sich mit Taschenlampe oder Laterne bewaffnet auf den Weg machen musste! Wen wundert es da, dass wenigstens für die Nacht unter jedem Bett ein Nachttopf stand, entweder aus emailliertem Metall oder aus bemalter Keramik, letzterer für gehobenere Ansprüche wie Besucher. Nein, die „stillen Örtchen“ mit ihrem Überfluss an frischer Luft waren gewiss kein einladender Platz für passionierte Zeitungsleser, was die Verweildauer natürlich erheblich verkürzte. Zeitungen gab es da zwar auch, aber die waren schon mehrere Wochen alt, bereits in zweckdienliche Stücke geschnitten und an einem Haken aufgehängt. Sie ersetzten schlichtweg das heutige Toilettenpapier.
Gefiederte Hofbewohner
Auf unserem Scheunendach befand sich wie bei fast allen Gehöften ein Storchennest. Der „Adebar“ galt natürlich auch bei uns als Glücks- und Kinderbringer. Ich sah dem lebhaftem Treiben auf dem Dache gerne zu, hasste es jedoch, aufgefordert zu werden, das Sprüchelchen „Storch, Storch, Ester, bring mir eine Schwester“ nachzuplappern. Zu unseren ständigen Sommergästen gehörten unter anderem auch Schwalben und Mauersegler, die ihre Nester unter den Dachüberhängen der Stallungen gebaut hatten und bei aufkommendem Regen/Gewitter auf der Jagd nach Insekten tief über dem Hofplatz hin- und herschossen. Sie waren praktisch unsere Wetterfrösche. Man pflegte zu sagen: „Wenn die Schwalben tief fliegen, gibt es Regen.“ Die Außenwände des Hauses waren dann mit einer Heerschar von Fliegen übersät.
Garten und Infrastruktur
Unser Wohnhaus war an zwei Seiten von einem großen Garten umgeben, an dessen Staketenzäunen (Lattenzaun) hohe Bäume als Windschutz standen: Eichen, Ahorn, Buchen, Birken und vor allem Tannen. An der Nordseite des Gebäudes befand sich ein großer Teich. Da er in regelmäßigen Abständen „entmodert“ wurde (Wasser abgelassen, Schlamm mit Hilfe von Loren und Schienen auf einen Haufen gefahren und nach ausreichender Lagerungszeit als natürlicher Gartendünger genutzt), war das Wasser auch zum Baden geeignet. Leider schmeckten die Fische (Karausche) trotzdem immer etwas moderig
Wie alle Dorfbewohner von Waldfrieden_(Ostp.) hatten wir weder elektrischen Stromanschluss noch fließendes Wasser. Bei der Abstimmung über das Für oder Wider der Verlegung einer Stromleitung hatte sich die Mehrheit seinerzeit aus Kostengründen dagegen entschieden. Mein Stiefvater träumte davon, sich sofort nach Ende des Krieges auf eigene Rechnung eine Stromleitung von dem ca.1 km entfernten Transformatorenhäuschen zu unserem Hof legen zu lassen, wie es das Moorbad Waldfrieden und das Gut Weidlauken bereits getan hatten. Drei Brunnen auf unserem Gehöft versorgten Mensch und Tier mit dem lebensnotwendigen Nass. Der dicht am Küchentrakt gelegene war mit einer Saug- und Druckpumpe ausgerüstet. Das Wasser wurde in Eimer gepumpt und in der Küche in eine mit einem Holzdeckel verschließbare hölzerne Wassertonne geschüttet. Ein Gefäß zum Schöpfen lag daneben - nach heutigen Begriffen also völlig unhygienisch. Damals wurde jedoch niemand krank davon, niemand sprach von Salmonellen. Das Quietschen des Pumpenschwengels habe ich noch heute im Ohr, und man sagte wohl mit Recht, jemand hätte eine Stimme wie ein verrosteter Pumpenschwengel. Dieser Schwengel schien mich kleine Marjell magisch anzuziehen. Hin und wieder packte mich der Ehrgeiz, mich nicht nur spielerisch dranzuhängen, sondern selbst einmal einen Eimer mit dem kostbaren Nass zu füllen. Wie würden sich die Dienstmädchen über meine Hilfe freuen! Doch so sehr ich mich auch anstrengte, meine Kraft reichte einfach nicht aus, meine Bemühungen blieben erfolglos. Bei sinkendem Wasserspiegel war das Wasserpumpen generell ein recht mühsames Unternehmen. Da mussten erst einmal ein bis zwei Liter Wasser in die obere Öffnung des Pumpenrohrs gegossen werden - zum Ansaugen. Wie erlöst war man, wenn der Brunnen daraufhin das benötige Nass hergab!
Trotz der drei Brunnen konnte es in besonders trockenen Sommern oder extrem kalten Wintern zu einer Wasserknappheit kommen. Dann mussten die Knechte und Mägde das Wasser für die Tiere aus dem Teich schöpfen und mit einer Peede (hölzernes Tragjoch über den Schultern für je einen Eimer rechts und links) in die Stallungen tragen. Bei lang anhaltender strenger Kälte war es mitunter sogar notwendig, Wasser in großen Tonnen aus dem Dorfteich heranzufahren, wie es auch andere Bauern taten. Unser Hausteich war dann mit einer etwa 35 cm dicken Eisschicht bedeckt, in die aus Sorge um die Fische mehrere Löcher geschlagen wurden, mit Bedacht aber stets in Ufernähe und an abgelegeneren Stellen, damit wir Kinder weiterhin die große Eisfläche zum "Krängeln" (siehe Link) und Schlittschuhlaufen nutzen konnten.
Mein Stiefvater glaubte nun, mit dem Bohren eines vierten Brunnens Abhilfe schaffen zu können. So wurde ein sogenannter Rutengänger bestellt, der mit seiner aus einer Astgabel oder einem Y-förmig gebogenen Draht bestehenden Rute / Wünschelrute das Gelände absuchte, und an genau der Stelle mit dem Graben begonnen, an der seine Rute nach unten ausschlug. Das sollte nämlich über einer Wasserader der Fall sein. Leider klappte es bei uns nicht. Ein Brunnenring nach dem anderen wurde versenkt, und wie gespannt wir auch in die Tiefe starrten und auf die aus der vermeintlichen Wasserader hervorschießenden Fontäne warteten, trat außer einem kleinen Rinnsal nichts zutage, sodass der tiefe Schacht wieder zugeschüttet werden musste. Hatte die Kunst des Rutengängers tatsächlich versagt? Oder hatte er diesen Platz nur in Ermangelung eines besseren vorgeschlagen, obgleich seine Rute hier nur schwach reagiert hatte? - Klar, dass wir Kinder nun ausprobieren wollten, ob wohl einer von uns ein geeignetes Medium wäre. Schnell hatten meine pfiffigen Brüder das benötigte Instrument aus einem Draht in Y-Form gebogen, mit dem wir dann nacheinander das Gelände um die Gebäude abschritten. Nichts! Doch als wir unser Experiment in die Zimmer verlegten, schlug die Rute bei mir in einer der Stuben nach unten aus. Konnte das sein? Mit verbundenen Augen wurde ich noch ein paarmal durch alle Räume geführt, und tatsächlich reagierte die Rute immer an derselben Stelle - ausgerechnet im Schlafzimmer meiner Eltern, dicht neben den Ehebetten. So war meine „große Entdeckung“ mehr als nutzlos, denn sie führte ja nicht zum Bau eines Brunnens, sondern schürte nur die Angst gegen die als schädlich eingestuften „Wasserstrahlen“.
(Laut Internet werden Wünschelruten mitunter noch heute eingesetzt. Es gibt sogar Rutengänger-Vereine, doch haben wissenschaftliche Studien einen Zusammenhang zwischen Wünschelruten-Ausschlag und Wasseradern nicht bestätigt.)
Altenteil
Auf unserem Hof lebten auch Opa und Oma Schlack als sogenannte Altsitzer mit Anspruch auf Altenteil (Ausgedinge, Leibgedinge). Das war die damals für Bauern übliche Altersversorgung, nachdem sie ihren landwirtschaftlichen Betrieb an einen Nachkommen (notfalls an einen sonstigen Dritten) übertragen hatten, der ihnen im Gegenzug die bei der Übergabe vereinbarten Leistungen auf Lebenszeit gewährte.
Laut Grundbucheintragung bestand das Altenteil aus folgenden Zuwendungen:
freie Wohnung, Brennmaterial, 1 Kuh zum Melken, 1 Schwein von 3 Zentner Lebendgewicht, 2 Eier am Tag, 3 Gänse, 850,- RM im Jahr.
Ich bin sicher, dass die Sachleistungen in dieser Form nie erfolgt sind, denn die Großeltern gehörten bei uns wie auch auf den anderen Höfen (Burba, Mosel, Haller, Schüssler, Loerchner, Fleiß) einfach zur Familie. Es wurde gemeinsam geschafft, gemeinsam gegessen, gemeinsam gefeiert und gemeinsam getrauert. Großeltern bedeuteten allgemein eine große Hilfe. Selbst wenn sie körperlich nicht mehr arbeiten konnten, hüteten sie doch noch die kleinen Enkelkinder. So sehe ich vor meinem geistigen Auge meinen Großvater mit dem Rücken gegen den Kachelofen gelehnt sitzen und mich auf seinen zum Schaukelbrett verschränkten Händen hin und her wiegen, oder ich sehe meine Oma, wie sie mir in der Pfanne schnell Mehlflinsen/Pfannkuchen oder Arme Ritter für ein von mir verschmähtes Mittagessen backt (mitunter zum Verdruss meiner Mutter, die meinte, die Marjell solle essen, was auf den Tisch käme, die aber selbst zur Pfanne griff, wenn Oma mal streikte.)
Dienstpersonal
Mit dem elterlichen Anwesen meines Stiefvaters in Tannenfelde waren rund 64 ha zu bewirtschaften. Bis zum Ausbruch des Krieges hatten wir immer zwei Dienstmädchen, das eine für die Stuben und die Versorgung des Geflügels, das andere für die etwas gröbere Arbeit wie Küche und Fütterung der Schweine.
Für die Pferde war ein Knecht verantwortlich, für die Kühe ein zweiter Knecht, der später durch einen Schweizer/Melker abgelöst wurde (siehe weiter unten). Bei vermehrtem Arbeitsanfall wurden Tagelöhner/-innen aus dem Dorf einbestellt, vorrangig natürlich unsere eigenen Leute, die auf dem Hof meines Stiefvaters in Tannenfelde wohnten. Bedarf bestand im Frühjahr beim Setzen von Kartoffeln, Rüben und Wrucken, später beim Behacken derselben, im Juni bei der Heuernte, im Sommer bei der Getreideernte, im Herbst beim Ernten der Kartoffeln und den anderen Hackfrüchten und im Winter schließlich beim Dreschen. Übrigens, beim Kartoffelsammeln verdienten sich die Arbeiterkinder aus dem Dorf gerne eine Kleinigkeit: Neben den Mahlzeiten bekamen sie 50 Pfennig pro Tag.
Eine weitere Hilfe waren mitunter Studenten und junge Männer aus dem Rhein-Ruhrgebiet, die als sogenannte Landhelfer den ganzen Sommer über bei uns blieben. In den letzten Kriegsjahren schickten uns die Behörden auch HJ-Jungen aus Insterburg zum Ernteeinsatz. Auf diese auf das Landleben nicht unbedingt erpichten Stadtkinder hätte mein Stiefvater gerne verzichtet, doch wäre eine Ablehnung (NSDAP) in damaliger Zeit nicht ratsam gewesen.
Als die Milcherzeugung durch Inbetriebnahme eines speziellen Fahrzeugs der Insterburger Molkereigenossenschaft, des sogenannten „Milchautos“, rentabel geworden war, vergrößerte mein Stiefvater die Viehherde - ein Anbau schaffte den dafür erforderlichen Platz - und stellte einen Schweizer/Melker ein, dessen ausschließliche Aufgabe es war, sich eigenständig um den gesamten Viehbestand zu kümmern und zweimal täglich die Milch in großen Aluminiumkannen ins Dorf zu der Milchsammelstelle an der Kies-Chaussee zu transportieren, wo das Milchauto sie abholte und die leeren Kannen von der Molkerei zurückbrachte, auf Bestellung auch gefüllt mit Molke oder Magermilch zur Aufzucht der Tiere. Bei allem war größte Sauberkeit gefordert. Auch musste die Milch bei warmer Witterung bis zur Ablieferung vorgekühlt werden. Als Kühlraum diente der Brunnen, in den die Milchkannen an Stricken herabgelassen wurden. Da das Milchauto auf keinen Fall verpasst werden durfte, stand dem Schweizer neben einem speziellen Fahrzeug auch ein eigenes Pferd, das sogenannte „Milchpferd“, zur alleinigen Verfügung.
Von Kühen und Butter …
Bis zur Einstellung des Schweizers wurden bei uns die Milchkühe überwiegend von weiblichen Personen gemolken, wie es auf kleineren Grundstücken bis zum Schluss der Fall war. Auf unserem Hof beherrschten alle die Kunst des Melkens, selbst mein Stiefvater, und so war es nur zu natürlich, dass ich es als kleines Mädchen auch lernen wollte. Mir also einen Melkeimer und einen niedrigen dreibeinigen Melkschemel geschnappt, mich vor das pralle Euter gesetzt und als erstes unter Anleitung meines Stiefvaters die Zitzen zu säubern versucht. Aber anscheinend war die Kuh mit meiner Handhabung nicht einverstanden und schlug mir ihren Schwanz gleich einmal schwungvoll um die Ohren. Und je länger ich mich abmühte, ihrem Euter ein paar Tröpfchen Milch zu entlocken, desto irritierter reagierte sie. So hieß es dann bald, i c h solle das man lieber bleiben lassen, i c h würde die Kühe nur „verderben“, sprich, die Tiere würden das Euter hochziehen und keine Milch mehr hergeben, womit dann später auch ein guter Melker seine liebe Not hätte. (Der Schweizer benutzte übrigens einen Einbein-Melkschemel zum Umschnallen: zeitsparender, hygienischer.)
Gebuttert haben wir selbst, denn ein Bauer hat ja als Selbstversorger so weit wie möglich von seinen eigenen Erzeugnissen gelebt. Bis zur Einführung des Milchautos war Buttern sowieso die einzige Möglichkeit, die überschüssige Milchmenge gewinnbringend zu verwerten. Und das ging so vor sich: Die Milch wurde frisch von der Kuh in einer Milchzentrifuge durch Drehen eines Schwungrades geschleudert. Durch den Umlauf der gelochten, handbetriebenen Trommel mit hoher Geschwindigkeit trennten sich die Fettpartikel ab und liefen durch ein Rohr nach außen in ein Tongefäß für Rahm/Sahne, während die Magermilch durch ein zweites, dickeres Rohr in einen Eimer floss und für die Aufzucht von Tieren verwendet wurde. Die Sahne musste mehrere Tage in der kühlen Speisekammer ruhen, bis sie etwas fester und somit reif fürs Buttern war. Das geschah bei uns im kühlen Keller mit Hilfe einer Buttermaschine. Durch Drehen eines Schwungrades wurde die sich im Inneren der tonnenförmigen Maschine befindliche Sahne von einer Art Holz-Quirl so lange geschlagen, bis sich Fettklümpchen zu größeren Flocken verbanden und diese sich letztlich zu einem Butterklumpen zusammenballten. Durch tüchtiges Kneten mit der Hand entfernte meine Mutter die restliche Flüssigkeit (Molke) und formte die fertige Masse in einem Holzmodel zu appetitlichen Stücken von 500 Gramm.
In Waldfrieden gab es so gut wie keine Möglichkeit, Milch oder Butter zu verkaufen. Denn selbst wer sich keine Kuh leisten konnte, besaß zumindest ein paar Ziegen, scherzhaft „Milchkühe des kleinen Mannes“ genannt. Glücklicherweise hatten wir in Insterburg Freunde mit einem Kolonialwarengeschäft, die uns die überschüssige Butter gerne zum Weiterverkauf abnahmen, während sich meine Mutter im Gegenzug mit zwar teuren, aber leicht zu transportierenden Waren aus ihrem Laden eindeckte wie Kaffeebohnen, Kakao, Mandeln, Schwarztee und dergleichen, also Kolonialwaren aus Übersee, deren Einfuhr im Laufe des Krieges immer stärker gedrosselt wurde. Einmal hat meine Mutter auch ausprobiert, Butter auf dem Insterburger Wochenmarkt anzubieten, sich aber so sehr über die Stadtfrauen geärgert - oder sich von ihnen gedemütigt gefühlt? -, dass sie es nicht ein zweites Mal versuchte. Die Damen gingen mit ihrem eigens dafür mitgebrachten Löffelchen von Stand zu Stand, schmeckten überall herum und versuchten dann, durch Herummäkeln die Preise zu drücken. Vorkriegszeit! Es stimmt jedoch, dass es für den Wohlgeschmack der Butter auf die Qualität der Sahne ankommt, somit also auch auf die Tierhaltung (Stall oder Weide) und Fütterung (Grün- oder Trockenfutter).
Nach Einführung des Milchautos wurde nur noch für den Eigenbedarf gebuttert. Für die kleinere Menge reichte ein Butterfass mit einem Stampfer aus. Als während des Krieges fast die gesamte Milch abzuliefern war und die Behörden daher die Milchzentrifuge durch Beschlagnahme eines bestimmten Teiles unbrauchbar gemacht hatten, mussten auch wir die uns nun zugeteilte Butterration von der Molkerei beziehen. Trotz vieler Milchkühe knapp an Butter? Nun, meine Mutter verstand es, täglich etwas Milch abzuzweigen und bei der Herstellung von Butter auf eine alte Methode zurückzugreifen, die man vor Erfindung der Milchzentrifuge angewandt hatte und die sicherlich bei Besitzern von nur einer Milchkuh noch immer gängig war: Man ließ die Vollmilch an einem kühlen Ort ruhen, schöpfte dann vorsichtig den sich oben angesammelten Rahm ab, der wiederum einige Tage ruhen musste u.s.w. Durch diese längere Verarbeitungszeit - ohne Kühlschrank! - vergrößerte sich natürlich die Gefahr, dass das Vorprodukt umkippte und nicht mehr zu gebrauchen war. Doch zum Glück verfügte meine Mutter über ein gutes Fingerspitzengefühl, das für eine Bäuerin einfach unerlässlich war, sodass wir auch in kargen Zeiten immer etwas Butter zum Zusetzen hatten.
Unsere Dienstboten verstanden ihr Handwerk und waren es gewohnt, hart zu arbeiten, hatten sie doch alle schon mit 14 bzw. 15 Jahren nach Beendigung der Volksschule in Stellung gehen müssen. Eine Ausnahme bildete das Pflichtjahrmädchen Herta, wohlbehütete Tochter eines Insterburger Bahnbeamten. Die hatte gerade die Mittelschule mit der Mittleren Reife abgeschlossen und strebte eine Ausbildung bei dem Insterburger Hauptpostamt an. Nach den Bestimmungen des 1938 eingeführten Pflichtjahres waren aber alle Mädchen unter 25 Jahren zu einem Jahr Arbeit in der Land- und Hauswirtschaft verpflichtet, bevor sie eine Lehre oder anderweitige Ausbildung beginnen durften. So kam dieses Stadtkind im Alter von 16 Jahren zu uns aufs Land. Ich erinnere mich gut an ihren ersten Arbeitstag: Ein Frühlingstag, die Kartoffelmiete war gerade geöffnet worden, und nun hieß es, die faulen Kartoffeln auszusortieren, natürlich ohne die aus unserem heutigen Leben nicht mehr wegzudenkenden Einweghandschuhe. Zwar handelte es sich hier um keine schwere körperliche Arbeit, doch wer den Geruch von verfaulten Kartoffeln kennt, weiß, dass diese Aufgabe kein Zuckerschlecken war. Um der nicht gerade glücklichen Herta etwas Trost zu spenden, setzten sich meine Mutter und ich zu ihr und griffen beherzt in den Kartoffelberg. Naja, meine Mutter ließ uns beide bald laufen, und Herta wurde mir eine geschätzte Weggefährtin. Zu ihren Eltern entstand ebenfalls ein guter Kontakt. Wiederholt kamen sie sonntags unangemeldet mit dem Mittagszug nach Waldfrieden und genossen bei uns ostpreußische Gastfreundschaft wie umgekehrt auch ich in ihrer gepflegten Stadtwohnung.
Arbeitszeiten
Der Arbeitstag auf dem Bauernhof begann sehr früh, besonders im Sommer; denn bevor es hinaus aufs Feld ging, mussten ja die Tiere gefüttert sein. Ich habe mir sagen lassen, dass Pferde sogar 1 ½ bis 2 Stunden zum Fressen brauchen. Ab meinem elften Lebensjahr bin ich ja selbst schon um 5:45 Uhr aufgestanden, um den Zug zur höheren Schule in Insterburg zu erreichen, und das empfand ich keineswegs als ungewöhnlich, war doch um diese Zeit im Haus und in den Stallungen schon alles in vollem Gange. Also, in der Landwirtschaft konnte man von einer Wochenarbeitszeit von 48 oder gar 40 Stunden nur träumen. Zwar waren die Samstage etwas ruhiger, denn für gewöhnlich standen außer Putzarbeiten nur die Vorbereitungen für den Sonntag an, doch einen freien Wochentag gab es nicht, musste doch auch sonntags gekocht, abgewaschen, die Betten gemacht und das Tierreich versorgt werden.
Außerdem kam an Sonn- oder Feiertagen, an denen wir viele Gäste eingeladen hatten - im heutigen Sprachgebrauch also eine Party gaben - zusätzliche Arbeit auf die Dienstboten zu. Die Knechte nahmen die Kutschen der Besucher in Empfang und kümmerten sich um deren Pferde, während die Dienstmädchen bei Tisch bedienten und natürlich einen Berg an Geschirr und Pfannen abzuwaschen hatten. Im Winter oder bei nassem Wetter waren sie den Besuchern auch bei der Garderobe behilflich. Wie seinerzeit üblich, wurden die vielen Mäntel / Pelzmäntel in einem Schlafzimmer säuberlich über die Betten gelegt und bei Aufbruch der Gäste wieder herbeigebracht. Ein Trinkgeld zu geben, war damals noch kaum in Mode. Erst allmählich gingen die Gastgeberinnen dazu über, ein dafür vorgesehenes Tellerchen auf den Garderobentisch zu stellen.
Für zusätzliche Arbeit wurde weder ein Lohnzuschlag noch ein Ausgleich durch Freizeit gewährt. Und was heute doch vollkommen undenkbar ist, gab es für die Dienstboten auch keinen Jahresurlaub, nahmen sich doch selbst die Bauern keinen. In meinem ganzen Umfeld kannte ich nur drei Familien, die zu verreisen pflegten. Aus Waldfrieden war das einzig und allein die Lehrerfamilie Hüber, deren alljährliches Zeil ihre Heimat, das Memelland, war, wo sie überwiegend Verwandte und Freunde besuchten.
Trotzdem waren alle zufrieden. Bei leichteren Feldarbeiten wie dem Wenden des Heues pflegten die Dienstmädchen sogar zu singen. Ich erinnere mich noch gut an ihre Lieder: „Du kannst nicht treu sein, nein, nein, das kannst du nicht“ oder „Es war einmal ein treuer Husar, der liebte sein Mädchen ein ganzes Jahr“ oder „Ja, ja, ja, ach ja, ist traurig, aber wahr, nein, nein, nein, ach nein, von einmal kann es nicht sein!“ Was wohl?, grübelte ich. Herrlich die Sommerabende, an denen die Knechte und Mägde zu Musik aus der Mundharmonika oder dem Grammophon vor dem Haus zu tanzen pflegten! Unvergesslich eine schon schadhafte Grammophonplatte mit ihrem „Waldeslu-u-u-ust, Waldeslu-u-u-ust, ach wie einsam schlägt die Brust…“! Die Winterabende verliefen ebenfalls recht harmonisch. Zum Leidwesen meiner Mutter hielt ich mich mit meinen Brüdern lieber bei den Leuten in der Küche als im Wohnzimmer auf. Es wurde hauptsächlich Karten gespielt, wobei ich zwar nur Zuschauerin war, aber mich doch durch intensives Beobachten und Nachfragen mit den Spielregeln von Sechsundsechzig, Schafskopf und Skat vertraut machen konnte.
An manchen Winterabenden saß meine Mutter mit den Mägden und sonstigen weiblichen Personen im Wohnzimmer zusammen, jeder bei dem anheimelnd warmen Licht der Petroleumlampe über seine Handarbeit gebeugt. Die meisten strickten sich dicke Wollsocken und Fausthandschuhe, ohne die man im Winter auf einem Bauernhof ja nicht sein konnte. Unter der Anleitung meiner Mutter brachten hier selbst unerfahrene Strickerinnen Prachtstücke zustande. Die einzige in der Runde, die sich nach meinem Empfinden mit etwas „Feinerem“ beschäftigte, war das Pflichtjahrmädchen Herta. Dieses junge Stadtkind, das unser ländliches Gefilde nach einem Jahr wieder verlassen und in seine städtische Umgebung zurückkehren würde, hatte sich nämlich hoch moderne Taschentücher zum Umhäkeln gekauft, die es nun mit kunstvollen Spitzenmustern versah. Schöne Taschentücher waren ein absolutes Muss, ein notwendiges Accessoire für jede Dame und dienten wohl weniger zum Putzen der Nase, als zum gekonnt koketten Tupfen hier und da - halt als Vorzeigeobjekt. Was hätte mir Herta zu Weihnachten wohl Besseres schenken können, als eines ihrer Kunstwerke? Klar, dass ich bald danach unter Anleitung der Lehrerfrau Hüber selbst zur Häkelnadel griff.
Es gab aber auch Winterabende, an denen für diese weibliche Tischrunde Arbeit angesagt war, und zwar mussten Enten- oder Gänsefedern gerupft werden, die später als Füllung für die selbst gestopften Kissen und Oberbetten dienten. Ich fand auch diese Abende recht anheimelnd, denn während die Fingerchen rupften und zupften, wurden Lieder gesungen oder den anschaulichen Erzählungen meiner Mutter gelauscht.
Essgewohnheiten
Grundsätzlich wurden alle Leute beköstigt, die bei uns arbeiteten. Es gab drei Mahlzeiten: Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Während der Sommermonate kamen zwei Zwischenmahlzeiten dazu: Klein-Mittag/zweites Frühstück um 9:00 Uhr, Kaffee um etwa 15:30 Uhr. Im Gegensatz zu dem nur leichten Frühstück mit Marmelade- oder Schmalzbroten - und auf Wunsch natürlich der ostpreußischen „Klunkersuppe“ aus Milch mit einer lockeren Mehlklümpchen-Einlage -, wurden die Brote zum Klein-Mittag mit einem herzhaftem Belag aus selbst gemachter Blut- und Leberwurst belegt, mitunter auch mit Rauchwurst (Salami). Zum Mittagessen gab es recht oft Suppen/ Eintöpfe im Sommer mit frischem Gemüse aus dem Garten, im Winter mit lagerungsfähigen Sorten wie Weißkohl, Mohrrüben und Gelbe Wrucken (Steckrüben), die man heute kaum noch kennt. Damals wurden sowohl gelbe und als auch weiße Wrucken angebaut, die gelben für die menschliche Ernährung, die weißen als Futter für die Tiere. Nicht vergessen darf ich die Gerichte aus getrockneten Erbsen- und Bohnen, die allen schmeckten. Alle Suppen waren stets mit Bauchspeck oder gepökeltem bzw. eingewecktem Schweinefleisch deftig-schmackhaft zubereitet.
Eine besondere Erwähnung verdient das Sauerkraut, das als typisch deutsches Nationalgericht angesehen wird und wahrscheinlich den Begriff „Krauts“ als stereotypisierende Bezeichnung für uns Deutsche prägte, eine Bezeichnung, die vor allem während des Ersten und Zweiten Weltkrieges in England und den USA gebräuchlich war. Ich erinnere mich, wie es mich kränkte, als ich die amerikanischen Besatzer im Nachkriegsdeutschland ganz selbstverständlich über „the Krauts“ (Kraut-Eater = Kraut-Esser) reden hörte. Wie dem auch sei, Sauerkraut war auch während der vitaminarmen Winterzeit auf jeden Fall ein wichtiger Vitamin C-Lieferant. Das in großen Holzfässern eingelegte Kraut aßen wir gewöhnlich geschmort, aber im Gegensatz zu anderen Regionen mit saurer Sahne verfeinert, oder als diese typisch ostpreußische Sauerkrautsuppe mit Schweinepfoten und -haxen, ersatzweise Bauchfleisch, aber stets mit einem Mehl-Sahne-Gemisch angebunden, was wohl nur einem Ostpreußen mundete. Gleiches trifft bestimmt auch auf „Schwarzsauer“ zu, einer sämigen Suppe aus Gänseklein/Gekröse mit Trockenpflaumen und Gänseblut, welches der Suppe eine nicht gerade einladende Farbe gab, wie es schon der Name andeutet: Schwarzsauer.
Nicht unerwähnt lassen darf ich die oft auf dem Herd anzutreffende Bratpfanne mit Spirgeln (Bauchlappen mit oder ohne Zwiebeln kross gebraten), verliehen sie doch vielen einfachen Gerichten das gewisse Etwas wie z. B. den Kartoffelnkeilchen (Keilchen = Klöße) aus rohen Kartoffeln. Diese Kartoffelkeilchen gab es auch in einer verfeinerten Version, nämlich als sogenannte Glumskeilchen: größere Keilchen, gefüllt mit angemachter Glumse (Quark), nach dem Kochen aufgeschnitten, in Butter gebraten und mit saurer Sahne übergossen serviert. Leichte, fleischlose Gerichte wie Kartoffelflinsen (Kartoffelpuffer), Mehlflinsen (Pfannekuchen) oder Milchreis - alle mit Zucker bestreut, ferner Apfel- und Pflaumenkeilchen - mit leicht gebräunter Butter übergossen und mit Zimt und Zucker bedeckt, kamen nur an Tagen auf den Tisch, an denen wir keine hart arbeitenden Tagelöhner einbestellt hatten.
Zum Abendessen sagten wir Abendbrot, und dieser Ausdruck beinhaltet ja schon das Wort Brot und weist somit auf eine Brotmahlzeit hin. Doch gab es des öfteren auch einfache, warme Gerichte wie Bratkartoffeln, Schmandkartoffeln (eine Art warmer Kartoffelsalat mit angebratenen Zwiebeln und Speck, angerührt mit einem Mehl-Sahne-Gemisch), Suppen wie Klunker-, Kürbis-, Sauerampfersuppe und Beetenbartsch (Suppe mit Roten Beten) und gegebenenfalls natürlich aufbereitete Reste vom Mittagessen. Beliebte Beilagen waren u.a. die von meiner Mutter in länglichen Terrinen eingelegten sauren Heringe oder Schmandheringe/Sahneheringe. Dickmilch und Buttermilch hatten ebenfalls ihre Liebhaber, doch das übliche Getränk zum Abendbrot war nun einmal Schwarztee. Überhaupt wurde sehr viel Schwarztee getrunken, selbst mittags zu bestimmten Gerichten wie Kartoffelflinsen oder Kartoffelkeilchen.
Am Herdrand stand stets eine kleine Keramikkanne mit Tee-Extrakt (viele Teeblätter mit wenig Wasser überbrüht), und da in einem Wasserkessel fast immer Wasser heiß gehalten wurde, konnte man sich jederzeit schnell einen Tee zubereiten. Zu einer Mahlzeit kamen Tee-Extrakt und kochendes Wasser stets getrennt auf den Tisch, und jeder mischte sich den Tee nach seinem Geschmack (heller, dunkler). Als es im Laufe des Krieges eines Tages hieß, es gebe keinen Tee mehr zu kaufen, fragte ich fassungslos: „Ja, was soll ich dann trinken?“ „Na, Kaffee“, war die lapidare Antwort, was mich noch mehr erschütterte, da man nicht Bohnenkaffee meinte, den ich liebte, sondern „Blümchenkaffee“ oder „Peschurr“, wie wir unser Eigenprodukt aus selbst gerösteter Gerste herabsetzend bezeichneten. Die Herstellung ging so vor sich:
In einem speziellen Röstkessel mit einer sich über dem Boden drehenden, mit der Handkurbel betriebenen Schaufelvorrichtung wurde G e r s t e solange über dem Feuer geröstet, bis sie den gewünschten Röstgrad erreicht hatte. Bei Bedarf wurde dann die jeweils benötigte Menge in einer Handmühle grob gemahlen und zusammen mit einem Stück Zichorie in einem Kaffeekessel mit heißem Wasser aufgebrüht und noch einmal zum Kochen gebracht. Danach musste man etwas warten, bis sich der Kaffee gesetzt hatte. Fertig! Der Geschmack und die Farbe des Kaffees hingen überwiegend von der Menge der zugegebenen schwarzbraunen Zichorie (Wegwarte) ab, die sowohl als Geschmacks- als auch als Farbverstärker diente.
Die Sonn- und Feiertage waren die Zeiten für Hähnchen-, Gänse-, Enten- und Putenbraten und für Hühnersuppen mit selbst gemachten Nudeln, wie man ja so weit wie möglich alles selbst herstellte. So auch den sonntäglichen Nachtisch in Form von Zitronencremespeise, Buttermilchspeise und dergleichen, deren Basis stets viel Eigelb, Eischnee und Gelatine waren. Puddingpulver aus dem Päckchen haben wir erst nach Einführung der Lebensmittelkarten gekocht, als man einfach alles kaufte, was „aufgerufen“/zum Verkauf freigegeben worden war. Auf jeden Fall hob sich das Sonntagsessen deutlich vom Alltagsessen ab, und man ging stets voll freudiger Erwartung zu Tisch.
Wenn die Arbeiter weit draußen auf dem Felde beschäftigt waren, wurden die beiden Zwischenmahlzeiten aus Zeitersparnis in Körben und Kannen zu ihnen hinausgetragen. Da bin ich gerne mitgegangen und habe auch stets für mich etwas mitgenommen. Denn ich fand es so gemütlich, mit diesen gut aufgelegten Leuten im Schatten eines Baumes, notfalls eines Kastenwagens, zu sitzen und ihren Gesprächen zu lauschen. Weniger begeistert war ich aber, wenn ich das Essen allein einem an der entferntesten Grundstücksgrenze pflügenden Knecht hinbringen sollte. Denn in unserem im allgemeinen weit überschaubaren Gelände gab es doch ein paar Vertiefungen zum Süden hin, die mir kleinem Mädchen nicht geheuer waren. Falls ich trotz Ausreden wie vorgeschobenes Bauchweh um den Auftrag nicht herumkam, ergriff ich mit der einen Hand das in Zeitungspapier (!) eingewickelte Brot, mit der anderen die Flasche mit Kaffee und sauste los, immer querfeldein, gegebenenfalls auch barfuß über Stoppelfelder, um mir den Weg zu verkürzen. Ich war es zwar wie alIe Kinder im Dorf gewohnt, im Sommer barfuß zu gehen, aber mit bloßen Füßen über Stoppeln zu laufen, wollte gelernt sein. Mit längeren Stoppeln kam ich ganz gut zurecht, ließen sie doch durch geschicktes Auftreten in Art des Schlurfens etwas umbiegen. Nein, die kurzen, harten Dinger waren die Peiniger und Verursacher wunder Fußsohlen. Aber geweint habe ich nicht, wollte ich doch mit den anderen Kindern mithalten können. Verbandsmaterial (Kosten!) kam übrigens selten zum Einsatz. Wir Landkinder hatten gelernt, hart im Nehmen zu sein.
Wenn es sehr heiß war, bekamen die Leute auch zwischen den Mahlzeiten Getränke wie Wasser, Saftwasser oder selbstgemachte Brause (aus Wasser, Zitronensaft und Natron) aufs Feld gebracht. Es konnte aber durchaus vorkommen, dass einige Frauen selbst bei stark schweißtreibender Feldarbeit wie dem Binden von Getreidegarben die Zwischengetränke mit der Begründung ablehnten, danach würden sie nur noch mehr schwitzen. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass sie auch bei größter Hitze nie leichte ärmellose Kleidung trugen, sondern Arme und Beine stets bedeckt hielten und das Gesicht durch ein weit über die Stirn gezogenes Kopftuch vor den aggressiven Sonnenstrahlen zu schützen versuchten. (Zum Ausgleich verzichteten die meisten jedoch auf ein gewisses Unterwäschestück, was bei den langen Röcken aber nicht weiter auffiel, sondern nur meine kindliche Neugier erweckte.) Wie mir unser Dienstmädchen Frieda auf meine bohrenden Fragen hin einmal anvertraute, würde man sie an sonnengebräunter Haut doch sofort als Magd erkennen und infolgedessen beim sonntäglichen Flanieren durchs Moorbad seltener ansprechen oder zum Tanz auffordern (z.B. von Soldaten),wohingegen Blässe als Zeichen besserer Herkunft gelte.
Saft für die Getränke war immer reichlich vorhanden. Neben vielen Beerensträuchern besaßen wir auch eine Anlage mit Kirschbäumen. Die Kirschen waren nicht so süß wie Süßkirschen, aber auch nicht so herb-sauer wie Schattenmorellen. Ich nenne sie daher „ostpreußische Sauerkirschen“. Wenn sie anfingen, sich leicht zu röten, hängte man nicht nur Vogelscheuchen in die Bäume, sondern auch Schlittenglocken, die mit langen, starken Schnüren verbunden eine gut funktionierende Lärmanlage gegen die gefräßigen Stare abgaben. Jeder, der gerade Zeit hatte, zog an der Hauptschnur und scheuchte durch das Geläute der Glocken die vielen, vielen „Kirschdiebe“ davon - allerdings immer nur für eine kurze Zeit. Bei der Hauptkirschernte mussten auch die Männer mithelfen, denn nur sie hatten die Kraft, die langen Holzleitern in/an die Bäume zu stellen. Um beide Hände zum Arbeiten frei zu haben und unnötiges Hoch- und Hinunterklettern zu vermeiden, band sich jeder Pflücker/jede Pflückerin eine Aluminium-Milchkanne um die Taille und ließ dann das gefüllte Gefäß an langen Schnüren hinunter, wo sie von einer eigens dafür eingesetzten Person ausgeleert und gleich wieder hoch geschickt wurde. Währenddessen saßen schon zwei bis drei Frauen vor großen Holzbottichen und entsteinten die Kirschen mit Hilfe von Haarnadeln für Saft und Kirschkreide (Kirschmarmelade). Für die Weiterverarbeitung war dann meine Mutter zuständig.
Auf Betreiben des Reichsnährstandes, einer 1933 gegründeten Trägerorganisation für die gesamte nationalsozialistische Agrarpolitik, versuchte meine Mutter auch ein bis zwei Jahre hindurch, aus verschiedenen Obst-/Beerensorten Most zu machen. Ein Großteil der Waldfriedener Hausfrauen hatte sich nämlich zusammengetan und gemeinsam eine Obstpresse gekauft, die Frau Hüber entgegenkommenderweise im Keller des Schulgebäudes aufstellen ließ und die Frauen in der Handhabung der Maschine sowie der Weiterverarbeitung des Mostes beriet. Der ausgepresste Obstsaft wurde in dunkle Glasflaschen abgefüllt, mit roten Gummikappen verschlossen und an einen kühlen, dunklen Ort (Keller) zum Reifen gestellt. Leider hielt die Begeisterung nicht lange an. Der Flascheninhalt wurde nämlich sauer und ging hoch (spritzte einmal sogar bis an die Decke). Also, es war ein richtiger Flop, und demzufolge schlief die ganze Sache bald wieder ein.
Schlachttage
Es dürfte aufgefallen sein, dass ich überhaupt noch keine Gerichte aus frischem Schweinefleisch erwähnt habe. Nun, Frischfleisch konnte es ja nur in Verbindung mit Schlachtungen geben, und die fanden normalerweise im Spätherbst und vor Ostern statt, also während der kälteren Jahreszeit. Denn in der sommerlichen Hitze wäre es äußerst problematisch gewesen, das Fleisch ohne elektrische Kühlvorrichtungen vor dem Verderben zu schützen, zumal die Schweinehälften vor der Weiterverarbeitung eine Zeitlang abhängen mussten. Im Winter wiederum wäre der eisige Frost zum Problem geworden.
Der Schlachtvorgang fand im Freien statt und verlief so: Schwein auf den Hof geführt, betäubt durch einen gut berechneten Schlag mit einer breitflächigen Holzkeule gegen die Stirn - ja nicht zu fest, um nicht das Gehirn zu zerquetschen! -, von zwei Männern in Seitenlage zu Boden gezwungen, an den Beinen gefesselt und festgehalten, durch meinen Stiefvater (oder einen einbestellten Fleischer) Stich in den Hals, herausschießendes Blut von meiner Mutter in einer Schüssel aufgefangen, toter Tierkörper so lange in einer Wanne mit heißem Wasser gelagert oder mit heißem Wasser übergossen, bis sich die Borsten lösten, dann die gesamte Behaarung komplett weggeschabt, gesäubert, die Haut mit Lötkolben kurz abgeflammt, Bauch aufgeschnitten, Innereien entfernt, Körper in zwei Hälften geteilt und an einem kühlen Ort zum Abhängen aufgehängt, danach durch einen „Fleischbeschauer“ (Tierarzt) auf Trichinenbefall untersucht und erst nach einem negativen Resultat weiterverarbeitet.
Diese Schlachttage waren jedesmal ein Highlight. Jetzt gab es auch Karbonade (Kotelett), gebratene Klopse oder die allseits beliebten gekochten Königsberger Klopse (ohne Kapern!), ferner deftige Schweinebraten mit herrlich krosser Schwarte, gebratene Leber mit Majoran, Zwiebeln und Äpfeln, und neben anderen Köstlichkeiten natürlich unsere herrlichen Spirgel, nun aber aus Frischfleisch hergestellt. Und dann erst die köstlichen Wurstsuppen, in denen ein paar aufgeplatzte Leber- und Blutwürste natürlich nicht fehlen durften!
Glücklich war der Hof zu nennen, dem eine erfahrene, tatkräftige Hausfrau vorstand, ging es doch nicht nur darum, das Frischfleisch und die daraus hergestellten Fleischprodukte kurzfristig vor dem Verderben zu schützen, sondern auch darum, den Großteil davon so geschmacksschonend zu konservieren, dass daraus selbst nach Monaten noch wohlschmeckende Gerichte zubereitet werden konnten und man somit nicht nur auf Salzfleisch (Pökelfleisch) und Rauchfleisch angewiesen war. Meine Mutter besaß alle Merkmale einer guten, umsichtigen Hausfrau. Von einem Bauernhof stammend, hatte sie, wie es seinerzeit üblich war, auf einem sehr großen Gut „die Wirtschaft erlernt“. So verarbeitete sie z.B. von der zubereiteten Leber- und Blutwurstmasse nur den kleineren Teil für Frischwurst im Darm, während sie den Rest in verbraucherfreundliche 1-Liter Gläser einweckte. Dadurch konnte appetitlicher Wurstbelag sogar bis zur nächsten Schlachtung o h n e Schimmelbildung serviert werden. Mit dem Fleisch verfuhr meine Mutter ähnlich: Nur ein Teil wurde eingesalzen/gepökelt, der Rest aber durch geschicktes Einwecken haltbar gemacht. Selbstgeräucherter Schinken war natürlich für jeden Hof eine Selbstverständlichkeit. Erwähnenswert dagegen ist die Rauchwurst (Salami), auf deren Herstellung meine Mutter spezialisiert war. Um eine Graufärbung der Fleischmasse zu verhindern, fügte sie nämlich ein paar Esslöffel Nitritpökelsalz hinzu, das der Wurst die schöne rote Farbe und das charakteristische Aroma verlieh. Ich sehe meine Mutter vor dem Wurstbottich stehen, abwägend, wieviel von dem Pökelsalz sie nehmen sollte/durfte, denn sie wusste sehr wohl, ein Mehr stand für ein schöneres Rot, ein Weniger aber für einen gesünderen Verzehr.
Unsere aus Ziegelsteinen gemauerte Räucherkammer befand sich auf dem Dachboden und war durch einen Schieber mit dem Schornstein/Kamin des Küchenherdes verbunden. Zum guten Räuchern gehörte Fingerspitzengefühl. Der Rauch musste die richtige Temperatur zwischen 20-25 Grad haben, was man durch langsames Verbrennen von Sägespänen harter Hölzer erreichte. Das starke Feuer, das man zum Kochen und Braten brauchte, konnte nichts genutzt werden. Also hieß es, vor jedem Aufheizen auf den Boden zu laufen und den Schieber in der Räucherkammer zu schließen und nach dem Kochprozess, wenn die Glut mit Hilfe von Sägespänen und ähnlichen Holzabfällen gedrosselt worden war, wieder zu öffnen. Meine Mutter war „die Hüterin des Herdes“, ich meistens diejenige, die bei Bedarf nach oben rannte, vor dem Öffnen der Tür zur Räucherkammer tief Luft holte, mit angehaltenem Atem durch die dunklen Rauchschwaden zum Schornstein stürmte und den Schieber betätigte. Wehe, wenn mir das nicht auf Anhieb gelang und ich den beißenden Qualm einatmen musste!
Ja, mit der Räucherkammer war ich bestens vertraut, habe ich mir doch hin und wieder ein Stück Rauchwurst abgerissen, solange sie noch weich war, und genüsslich auf der Lucht (Dachboden) verzehrt. Noch besser waren die geräucherten Heringe, die es aber nur einmal im Jahr gab, und zwar im Herbst, wenn der „Heringsbändiger“ (fahrender Fischhändler) mit seinem von zwei klapprigen Pferdchen gezogenen Gefährt übers Land zog und neben Salzheringen auch grüne Heringe, geräucherte Sprotten und geräucherten Aal anbot. Während meine Mutter von den Salzheringen immer gleich ein ganzes Fass nahm, waren die Heringe doch preiswert und ließen sich im kühlen Keller selbst bis zum nächsten Frühjahr frisch halten, verringerte sich die von ihr gewünschte Menge von den zum Braten und Räuchern bestimmten grünen Heringen über die Sprotten bis hin zum Räucheraal immer mehr, woraus zu schließen ist, dass letzterer schon damals relativ teuer gewesen sein muss. Nun war es aber gerade dieser Räucheraal, auf den meine Brüder und ich so scharf waren und von dem wir nie genug bekommen konnten. Zum Glück nahm der Fischhändler auch Alteisen zur Verrechnung entgegen, was uns Kinder anspornte, flink alle dafür in Frage kommenden Plätze abzusuchen - Alteisen gegen geräucherten Aal! Naja, mein Stiefvater war klug genug, unsere herbeigetragenen Schätze erst einmal durchzusehen, bevor sie auf der Waage des Händlers landeten, denn sonst wären mitunter noch brauchbare Teile „abhanden“ gekommen. - Übrigens, grüne Heringe zu braten, ist heute sicherlich nicht mehr üblich. Ich erinnere mich: ausgezeichneter Geschmack, aber beim Braten ein stark ausgeprägter, unangenehmer Fischgeruch.
Die Räucherwaren blieben auch nach Beendigung des Rauchvorganges in der Räucherkammer hängen und wurden erst bei Bedarf Stück für Stück herausgeholt, hätte es doch keinen geeigneteren Aufbewahrungsort als dieses fensterlose, keimfreie Gelass für sie geben können. Man war ja immer bemüht, nichts anschimmeln/verschimmeln zu lassen, doch ging man im Gegensatz zu heute viel sorgloser und vor allem viel sparsamer mit angeschimmelten Lebensmitteln um: schimmelige Stellen wurden einfach dünn (!) abgeschnitten/ausgeschnitten sowie etwaiger Schimmel auf Marmelade leicht (!) entfernt und der Rest ohne jegliche Bedenken verzehrt.
Kälber wurden nur zu besonderen Anlässen geschlachtet; denn die Jungtiere (Kälber, Jungbullen, Färsen) ließen sich sehr gut verkaufen und ergaben somit eine äußerst geschätzte Einnahmequelle. Besonders wertvoll war ein weibliches Kälbchen. Mitunter blieb es auch im eigenen Besitz, um den Bestand der Milchkühe zu vergrößern. Das Bestreben war ja stets, nicht nur Hab und Gut zu erhalten, sondern es nach Möglichkeit zu vermehren.
Leider passierte es zweimal, dass ein Rind notgeschlachtet werden musste. In beiden Fällen handelte sich um „Windsucht / Blähbauch“ (Meteorismus), verursacht durch Fressen ganz jungen (feuchten?) Klees. Es war allgemein bekannt, dass es von zu jungem, frischem Futter zu einer starken Gasebildung im Magen und in den Därmen mit lebensbedrohlicher Spannung und Ausdehnung kommen konnte, die ohne schnelle Gegenmaßnahmen einen schnellen Tod zur Folge hatten. Ich erinnere mich, dass man die aufgedunsenen Tiere in ständiger Bewegung zu halten versuchte. So führte man sie z.B. auf dem Hof umher bzw. zerrte sie hinter sich her und/oder massierte ihren Bauch mit Strohwischen, um die Ausscheidung der Gase voran zu treiben. Hatte diese Behandlung keinen Erfolg, kam man nicht umhin, den Tierarzt zu rufen, der dem Tier mit einem Stechinstrument durch die Rippen stach - in den Darm? - , um der Luft einen Austritt zu verschaffen. Einmal war es so dringend, dass mein Stiefvater das Eintreffen des Tierarztes nicht abwarten konnte, der ja mit dem Fuhrwerk von Aulenbach abgeholt werden musste, sondern couragiert selbst zum Bajonett griff und mit einem gottlob geglückten Stich der Kuh das Leben rettete. Die Folgen von Frischfutter kennend, ist man bei der Fütterung gewiss sehr vorsichtig gewesen. Dass Tiere trotzdem an diesem Blähbauch erkrankten, war auf eine bestimmte Nahrungsquelle zurückzuführen, und zwar auf den Kleesamen, der zusammen mit dem Wintergetreide eingesät wurde und dann im Sommer nach Abernten des Getreides wie ein grüner Teppich aus dem Stoppelfeld hervorschoss. Aus lauter Gier nach diesem jungen, saftigen Grün gelang es unseren Kühen immer wieder einmal, den Weidezaun zu durchbrechen und sich auf dem benachbarten Feld über das verlockende Futter herzumachen - mit den oben geschilderten Folgen. Wie schon eingangs erwähnt, konnte auch der Tierarzt in zwei Fällen nicht mehr helfen. Es mussten Notschlachtungen vorgenommen werden, um wenigstens das Fleisch zu retten, einen Teil davon für den eigenen Verbrauch, den Überschuss für den Notverkauf an Nachbarn und Bekannte. Das war immerhin besser, als den Abdecker holen zu müssen.
Gastfreundschaft, Gastlichkeit
Gastfreundschaft war etwas Typisches für Ostpreußen. Niemand wurde vor der Tür abgefertigt, sondern ins Haus gebeten und bewirtet, selbst wenn er unerwartet und zu einem ungünstigen Zeitpunkt auf unseren Hof kam. Ich schreibe mit Absicht nicht "wenn er unerwartet vor unserer Haustüre stand", denn das gab es nicht. Die Hunde meldeten jeden Fremden an, und besonders der frei umherlaufende „Prinz“ ließ ohne unseren Zuspruch niemanden ans Haus heran. Das heißt, sobald die Hunde anschlugen, lief sofort jemand von uns hinaus. Nein, die Hunde waren nicht „gastfreundlich", weder bei uns noch auf anderen Höfen, und man tat gut daran, sich fremden Grundstücken vorsichtig zu nähern.
Ich muss hervorheben, dass damals so dubiose Gestalten wie heute nicht herumliefen. Vormittags handelte es sich überwiegend um männliche Besucher, die in geschäftlichen Angelegenheiten zu meinem Stiefvater kamen, der u.a. einen Posten beim „Reichsnährstand“ hatte. Außerdem besaßen wir einen Zuchteber und einen Zuchtbullen, zu denen die kleineren Bauern ihre Tiere zum Decken brachten, da für sie die Anschaffung und Haltung dieser teuren gekörten Zuchttiere nicht wirtschaftlich gewesen wäre.
Kaum hatten die Leute im Wohnzimmer Platz genommen, stellte mein Stiefvater schon Schnaps und Zigaretten auf den Tisch, für "höhere" Gäste auch die Zigarrenkiste. Als alkoholisches Getränk wurde meistens Rum mit einem Stückchen Würfelzucker serviert. Bei den Zigaretten handelte es sich ausschließlich um die Marke "Güldenring", 30 (?) Stück aufrecht stehend in einer herrlich goldgelben, ovalen Blechdose. Ich war ganz scharf auf die leeren Behälter, mußte jedoch zu meinem Leidwesen immer recht lange auf einen warten, da mein Stiefvater nur bei Besuch zu rauchen pflegte. Erwähnenswert ist, daß Raucher seinerzeit nicht wählerisch waren und jede angebotene Zigarette dankbar annahmen. Die Sitte, seine eigene Lieblingsmarke in der Tasche zu haben und ausschließlich nur diese Marke zu rauchen, habe ich erst später bei den amerikanischen Soldaten beobachtet.
Je nach Stand des Gastes ließ mein Stiefvater auch ein „Klein-Frühstück“ auftischen, das gewöhnlich aus ein paar Scheiben geräuchertem Bauchspeck mit drei Rühreiern pro Person bestand. Und falls jemand um die Mittagszeit bei uns war, wurde er selbstverständlich zum Mitessen eingeladen - ohne das deshalb die Suppe mit einem Liter Wasser verlängert werden musste, wie man scherzhaft zu sagen pflegte. Ein bestimmter Personenkreis wusste das durchaus wahrzunehmen. Zum Beispiel richtete es der „Rumträger“ (fahrender Händler) stets so ein, gerade um die Essenszeit mit seinem mit Koffern voll bepackten Fahrrad bei uns vorbeizukommen. Bei dem gemeinsamen Mahl waren wir schon immer sehr gespannt auf seine Waren, die er später auf dem abgeräumten Esstisch ausbreiten würde. Es waren dies Kleiderstoffe, Unterwäsche für Damen und Herren, Kurzwaren und dergleichen nützliche Dinge, alles auf das Landleben abgestimmt wie die auf der Innenseite flauschig-warm angerauten (Winter-) Schlüpfer und Unterhosen. Die Sachen des „Rumträgers“ fanden immer Abnehmer, auch bei den Dienstboten, soweit es deren Geldbeutel erlaubte. Ich darf hervorheben, dass meine Mutter den Händler schon aus Mitleid nie hätte weiterziehen lassen, ohne ihm etwas abzukaufen.
Bei weiblichen Besuchern - meistens handelte es sich um Freundinnen meiner Mutter oder meiner Oma, die nachmittags einfach mal so unangemeldet vorbeikamen - waren die beiden Frauen ein gut eingespieltes Team. Sobald sie des Besuches ansichtig wurden, banden sie sich schnell eine bessere, möglichst bestickte Schürze um, und während die eine den Gast/die Gäste unterhielt, ging die andere in die Küche und holte das Waffeleisen hervor oder backte "Weiberohren" in schwimmendem Fett aus. („Weiberohren“: ein Knettag mit Natron als Treibmittel, in Stücke geschnitten und zu bizarren Gebilden geformt, nach dem Backen mit Puderzucker bestreut.) Denn da wir keinen elektrischen Strom hatten, konnten wir auf die Schnelle auch keinen Kuchen in den Ofen schieben. Und etwas Kuchenartiges musste sein!
Der höchste Genuss war zweifelsohne der Bohnenkaffee, den es wirklich nur bei Besuch und evtl. am Sonntagnachmittag gab, aber da hatten wir ohnehin fast immer Gäste. Bohnenkaffee war ein Luxusartikel. (1928 betrug der Preis etwa 6,82 RM, d.h. in meinem Geburtsjahr mußte man ungefähr 26 Stunden für ein Kilo Kaffee arbeiten.) So ist es kein Wunder, daß meine Mutter für gewöhnlich kleine Mengen von einem 1/4 oder 1/2 Pfund erstand und nur vor einer größeren Einladung etwas mehr. Herrlich der Duft, wenn die Bohnen jedesmal frisch in der handbetriebenen Kaffeemühle gemahlen wurden! Das Kaffeemehl überbrühte man einfach in einer vorgewärmten Kanne mit kochendem Wasser, ließ es abstehen und goss dann den fertigen Kaffee durch ein kleines Sieb direkt in die dünnwandigen Tassen. Bei größeren Mengen wurde der Kaffee natürlich vor dem Servieren durch ein Sieb in eine angewärmte zweite Kanne umgefüllt. Als dann später Kaffeefilter in Mode kamen, lief es bei einer Einladung so ab: Ich postierte mich auf dem Dachboden, meine Brüder an einer anderen günstigen Stelle, von wo aus wir die Wege "meilenweit" überblicken konnten, und sobald wir die ersten Gäste erspähten, z.B. Haeskes (Gastwirt u. Kolonialwarenhändler aus Mittel-Warkau) im Pferdefuhrwerk von links oder Hübers (Dorfschullehrer) auf dem Fußweg von rechts, rannten wir mit dem Ruf "Sie kommen! Sie kommen!" in die Küche, und die Frauen begannen mit dem Filtern des Kaffees. Es war nämlich Sitte, s o f o r t zu Tisch zu bitten und mit dem Essen zu beginnen. Es gab also davor keine „social hour“/ kein geselliges Beisammensein, was wir meiner Meinung nach erst nach dem Krieg von den Amis übernommen haben.
Ein Überraschungsbesuch am Abend bedeutete ebenfalls kein Problem. Vor allem war es die Lehrerfamilie Hüber, die öfter zu einem Plausch erschien. Es wurden einfach Eier gekocht und mit Brot, Butter und in Gläsern eingeweckter Blut- und Leberwurst auf den Tisch gestellt, ergänzt durch geräucherten Schinken und Rauchwurst (Salami). Dazu gab es Schwarztee, auf Wunsch auch mit einem Schuss Rum. Im Winter bevorzugten vor allem die Herren einen steifen Grog aus reichlich Rum, heißem Wasser und Zucker, wobei es hieß: „Rum muss, Wasser kann“. Kräutertee pflegte man nicht anzubieten, denn die bei uns gebräuchlichen Sorten wie Kamille-, Pfefferminz- oder Holunderblütentee galten als Heiltee bei Unpässlichkeiten. Holundersträucher gab es wohl auf jedem Anwesen. Die Blüten wurden regelmäßig geerntet und getrocknet und kamen mit heißem Wasser überbrüht auch mit Erfolg bei kranken Jungtieren (Durchfall) zum Einsatz.
Gastfreundschaft: Selbst Minderheiten wie die nicht sesshaft gewordenen Zigeuner, die im Planwagen übers Land zogen und sich in Abständen bei uns einfanden, wurden nicht vor der Haustüre abgefertigt, sondern durften in der Küche eine Mahlzeit einnehmen. Je nach Tageszeit bekamen sie Brot, Butter, Speck, eingelegte Heringe oder Fladen (Streuselkuchen aus Hefeteig) vorgesetzt, letzteres, um etwas Weiches für die Babys zu haben. Die Mütter hatten da eine einfache Methode: Sie kauten die Brocken vor und schoben den Brei den Kleinen in den Mund. Mit allerlei Nahrhaftem und etwas abgelegter Wäsche versehen, fuhren sie dann dankbar weiter, allerdings nicht, ohne meiner Mutter vorher aus der Hand zu lesen. Da half ihr kein Protest. Sie verstanden es meisterhaft, sich ihrer Hand zu bemächtigen. (Wir alle wissen. daß die Zigeuner eines Tages „verschwunden“ waren, selbst die Sesshaften mit einer festen Arbeitsstelle wie die auf dem Gut Buchhof oder aus dem Schuppinner Bruch.)
Unsere Gastfreundschaft zeigte sich besonders bei „Dauergästen“, die 2-3 Wochen oder sogar länger bei uns blieben wie die Besucher aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet, das damals bei uns Rheinland hieß. Zum besseren Verständnis muss ich auf die Zeit nach dem 1. Weltkrieg zurückgehen, in der sich viele junge Männer durch die schlechte wirtschaftliche Lage in Ostpreußen gezwungen sahen, im Rheinland auf Arbeitssuche zu gehen. Es ist ihnen dort nichts geschenkt worden, doch mit Zähigkeit, ostpreußischem Fleiß und Sparsamkeit gelang es ihnen, sich eine Existenz aufzubauen. Die Bräute holten sie sich aus ihrer ostpreußischen Heimat nach. So kam die Schwester meiner Mutter nach Wuppertal, eine Schwester meines Stiefvaters nach Köln, während eine andere Schwester ihrem Jugendfreund aus dem Nachbardorf Lindenhausen nach Leverkusen folgte, wo er bei BAYER -Leverkusen eine Anstellung als Schlosser gefunden hatte (und Jahre später sogar zwei Häuser sein eigen nennen konnte). Der Wunsch, die Verwandten und somit die Heimat möglichst oft wiederzusehen, ist wohl für jeden Ostpreußen nur zu verständlich.
In unserer Familie waren es hauptsächlich die „Wuppertaler“ (Tante und Onkel mit den Kindern Kurt und Ursula), die jeden Sommer einen dreiwöchigen Urlaub auf unserem Hof verbrachten. Für meinen Onkel als Bahnbeamten war die weite Bahnreise mit der Familie kostenlos, sodass sie auch zu größeren Familienfesten kommen konnten. Ihre Besuche waren uns immer willkommen. Selbst von Bauernhöfen stammend, kannten sich Onkel und Tante ja bestens mit ländlichen Gepflogenheiten aus. Es war vor allem meine Tante, die, kaum angekommen, ihre Reisekleidung gegen Arbeitskleidung eintauschte und meine Mutter am Herd und Backofen zu entlasten suchte.
Und wie verhielt es sich mit den Fremden aus dem Reich, die zum ersten Mal in unsere Gegend kamen? Ihre Vorurteile und Befürchtungen waren nach kurzer Zeit ausgeräumt und machten echter Begeisterung Platz. Immer wieder wurde betont, dass man sich Ostpreußen so schön, so gemütlich und so gastfreundlich nicht vorgestellt hätte und man bestimmt wiederkommen würde. Einige sind tatsächlich wiedergekommen! Mitunter entstanden Freundschaften, die bis ans Lebensende währten. Als Beispiel will ich Jansens aus Mönchen-Gladbach anführen.
Als die beiden Söhne einen Sommer als „Landhelfer“ bei uns verbrachten, setzten sich die Eltern einfach in den Zug und kamen sie besuchen. Sie wurden wie selbstverständlich von uns aufgenommen und bekamen zum Abschied noch ihren Koffer mit Lebensmitteln gefüllt, was ihnen Tränen in die Augen trieb. Sie zeigten ihre Dankbarkeit auf vielfältige Weise. Nach dem Krieg waren nun sie es, die uns, die Flüchtlinge, zu unterstützen versuchten, obgleich sie ja selbst nicht viel besaßen. So schickte uns Frau Jansen u.a. sehr moderne, eigenhändig geklöppelte Tischdecken und Zierdeckchen in allen Größen, womit wir in Ermangelung von Möbeln unsere Kisten zu kaschieren versuchten.
In den letzten Kriegsjahren wurde unsere Gastfreundschaft schon sehr strapaziert. Das lag nicht nur an den kleiner werdenden Lebensmittelzuteilungen, die die Städter verstärkt zu einem Besuch auf einem Bauernhof bewegte, sondern hauptsächlich an den Luftangriffen, unter denen die Großstädte im Westen zu leiden hatten, während es bei uns bis zum Sommer 1944 verhältnismäßig ruhig blieb. Daher zog es Frauen und Mütter mit Kindern verstärkt in unsere Gegend, teils auf Eigeninitiative hin, teils aber auch behördlich organisiert wie z.B. die „ Bombenevakuierten aus Berlin“, von denen wir nach amtlicher Inspektion unseres Hauses mit Zimmerbeschlagnahme eine Mutter mit 16-jähriger Tochter Leonie zugewiesen bekamen. Ich möchte hervorheben, dass wir über diese Zuweisungen/Einweisungen keineswegs erfreut waren und sie zu umgehen suchten, zumal die für Logiergäste geeigneten Räume meistens schon belegt waren. Doch standen die Leute erst einmal vor unserer Tür, wurden sie mit Herzlichkeit aufgenommen und gehörten während ihres Aufenthaltes zu dem Kreis, der mit uns lebte und am selben Tisch aß - kostenlos, versteht sich.
Unter den auf eigene Initiative angereisten „Verwandten“ waren erstaunlicherweise einige, zu denen wir bis dahin keinerlei Verbindung gehabt hatten. Ich denke dabei hauptsächlich an eine alte Oma aus dem Rheinland, die von ihrem Enkelsohn, einem Major auf Urlaub, ohne Einladung, ohne vorherige Absprache per Bahn zu uns in die „Winterfrische“ gebracht wurde. Es handelte sich um eine uns gänzlich unbekannte Cousine des Ehemannes der Schwester meiner Mutter. Und was zu befürchten war, trat ein: Auf dem winterlichen Weg zum Plumsklo stürzte diese gebrechliche Dame und zog sich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Das war seinerzeit kein Grund für eine Aufnahme im Krankenhaus, und da die Verletzte für die weite Heimreise nicht transportfähig war, lag sie wochenlang bei uns und musste von meiner Mutter gepflegt werden.
Der Bauernhof, eine Erlebniswelt für Kinder
Ein Bauernhof war für Kinder eine breitgefächerte Erlebniswelt. Allein schon die Tiere boten ein weites Betätigungsfeld. Am stärksten zogen uns natürlich die Neugeborenen an, egal, ob Kälbchen, Fohlen, Ferkelchen oder gerade aus dem Ei geschlüpfte Küken, Entchen, Gisselchen (Gänschen) oder Puten. Beim Durchstreifen der Wiesen, Felder und (leider nur kleinen) Wälder konnten wir auch Lebewesen in der freien Natur beobachten sowie den Jahresablauf mit Säen und Ernten, Blühen und Verblühen bewusst in uns aufnehmen. Zum Herumtollen und Versteckspielen gab es so wunderbare Plätze wie die geheimnisvoll halbdunklen Heuböden über den Stallungen, die große Scheune, deren Fächer entsprechend der Jahreszeit mit Getreide und/oder Stroh hoch aufgefüllt oder fast leer waren, und den dahinter im Freien aufgetürmten Strohhaufen, den wir auch als Rutsche benutzten.
Die sowohl in der Garage als auch in der Holz- und Wagenschauer untergebrachten Maschinen, Geräte und das Großangebot an Handwerkszeug luden zum Herumwerkeln und Experimentieren ein. Interessant - besonders für Jungen - war auch ein Besuch der Schmiede. Des Weiteren gehörten zu unserer Erlebniswelt vier Teiche und der dicht hinter unserer Scheune vorbeifließende Arm der „Droje“, nicht zu vergessen der Garten mit seinen vielen hohen Bäumen zum Herumklettern, die schattige Linden-Laube und das wetterfeste, mit bequemen Polsterbänken ausgestattete „gemütlich-lauschige“ Gartenhäuschen (ehemaliger Kastenwagen der „Olga-Bahn“).
Diese Plätze hatten für uns Kinder eine wichtige Eigenschaft: Sie ließen sich vom Wohnhaus aus nicht überblicken, wie das (mitunter verborgen hinter einer Gardine stehend) mit dem Hofplatz der Fall war, und entzogen sich somit einer etwaigen Beobachtung/Kontrolle der Eltern. Das erhöhte natürlich den Reiz unserer Unternehmungen.
Klingt das alles nicht mehr nach Spiele für Jungen als nach dem „Püppchen-wiegen“ eines kleinen Mädchens? Ich bin in der Tat - zumindest bis zu meinem 7. Lebensjahr - wie ein Junge aufgewachsen, immer im Schlepptau meiner beiden fünf und sieben Jahre älteren Brüder und deren Spielgefährten. Denn da es in „unseren Kreisen“ kein Mädchen in meinem Alter gab und ich gemäß ostpreußischem Klassendenken nicht mit Arbeiterkindern spielen sollte, hatte ich erst 1935 durch den Zuzug der Lehrerfamilie Hüber die Möglichkeit, in deren Tochter Hannelein eine echte Freundin zu finden und durch sie auch den Zugang zu Puppen.
Natürlich konnte ich mit den Jungen in vielem nicht mithalten und war oftmals nur ein geduldeter Mitläufer. Auch trug ich des öfteren Blessuren davon; doch wurde darum kein Aufhebens gemacht. Im Gegensatz zu heute ging man recht sorglos mit Wunden um: kleinere wurden gar nicht beachtet, größere spülte meine Mutter gegebenenfalls mit Wasserstoff (Wasserstoffperoxid) aus, wie sie auch ein mit Blut verkrustetes, angeklebtes Pflaster löste, danach ein Stück Hansaplast oder Leukoplast drauf - und weiter ging’s. Ich kann mich heute nur wundern, dass alles ohne Blutvergiftung ablief und dass man selbst bei langen, tiefen Verletzungen nicht zum Arzt zur Wundbehandlung/zum Nähen fuhr, was die selbst in meinem hohen Alter noch immer sichtbaren Narben belegen.
Wenn nun die Jungen dieses und jenes ausprobierten und hier und dort herumdrehten und -schraubten, brachten sie mich mitunter ungewollt in eine höchst gefährliche Situation. Im Eifer ihres Tuns vergaßen sie einfach, auf die kleine, lästige Marjell acht zu geben. So setzten sie einmal die Dreschmaschine in Gang, als ich von ihnen unbemerkt hinaufgeklettert war und ausgerechnet auf der Schräge vor der Öffnung mit den sich drehenden scharfen Messern kauerte, wo normalerweise die aufgeschnittenen Getreidegarben hineingeschoben wurden. Gott sei Dank ist nicht Schlimmes passiert, und meine Eltern haben weder von dieser Aktion noch von den anderen risikoreichen Spielchen etwas erfahren, wodurch uns unsere große Freiheit erhalten blieb. Ein Gebot gab es allerdings zu beachten: Was immer wir taten, die Bedientesten/Arbeiter durften durch unsere Spielchen und Streiche weder belästigt, noch bei ihrer Arbeit behindert und schon gar nicht um ihre Nachtruhe gebracht werden. So musste mein Bruder Herbert einmal ein tüchtiges Donnerwetter über sich ergehen lassen, als er heimlich einem Dienstmädchen eine von ihm mit dem Tesching erlegte Krähe in den Bettbezug gesteckt hatte und das arme Lottchen nachts in panikartige Angst geriet. Denn wenn immer sie im Dunklen von dem Unheimlichen in ihrem Bett weiter zur Wand abrückte, folgte es ihr prompt, da sie es ja mit dem Oberbett mitzog. Zum Lichtschalter greifen? Wie denn, hatten wir doch keinen elektrischen Strom!
Nachdem ich Hannelein als Freundin hatte und wir täglich beisammen waren - denn auch sie hatte ja außer mir niemanden in Waldfrieden, mit dem sie spielen sollte -, kamen natürlich neue Interessen hinzu. Für meine Brüder war die Kindheit mit Beendigung der Volksschule sowieso bald vorbei. Sie halfen nun auf dem Hof mit. Hauptsächlich fuhren sie die landwirtschaftlichen Maschinen wie Trekker, Selbstbinder, Mähmaschinen, Harkmaschinen und dergleichen, machten also die „besseren“ Arbeiten.
Auf Initiative unseres Stiefvaters durfte Herbert, der Älteste, in den Wintermonaten noch einmal die Schulbank drücken und zwar die der Landwirtschaftsschule in Insterburg. Diese wurde auch „Winterschule“ genannt, weil der Unterricht nur während der kalten Jahreszeit stattfand, damit dem Hof in den Sommermonaten die Arbeitskraft des Schülers auch weiterhin zur Verfügung stand. Für Herbert muss es frustrierend gewesen sein, sein neu erworbenes Wissen über Ackerbau und Viehzucht auf dem elterlichen Hof nicht anwenden zu können. Ich erinnere mich an Vorschläge, die er z.B. in Bezug auf Anbaufolge und Düngung machte, doch unser Stiefvater ließ sich keineswegs dreinreden oder gar das Zepter aus der Hand nehmen. Nun, eines Tages würde ja auch Herberts Zeit kommen, war er doch als ältester Sohn derjenige, der aus damaliger Sicht nach den Bestimmungen des „Reichserbhofgesetzes“ unseren Besitz als „Anerbe“ überschrieben bekommen sollte. Dazu später mehr.
Erlebnisse mit Haustieren
Natürlich waren wir Kinder mit dem Nutztierbestand , bestens vertraut, hatten daneben aber auch unsere eigenen Streicheltiere. So war ich z.B. die „Katzen-“ und „Hundemutter“ und besaß neben vielen Miezen stets ein bis zwei eigene Hunde, deren Privileg es war, frei herum zu laufen und nachts im Hausflur oder in der Küche schlafen zu dürfen, während die beiden Hofhunde tagein, tagaus an ihrer Hundehütte angekettet blieben. Eine der Hundehütten stand wie auf fast allen Bauernhöfen mitten auf dem Hofplatz, während die andere in die Scheunenwand integriert und somit nicht so stark der Witterung ausgesetzt war. Dagegen musste die Hofhütte in den eisigen Wintern mit Stroh und Erde abgedeckt und der Boden mit einem dicken Strohlager versehen werden, um dem Hund wenigstens etwas Schutz zu bieten. Zwar versuchte ich ein paarmal, einen Sack als Windfang an die Öffnung anzubringen, doch der starke Wind machte meine Bemühungen stets schnell zunichte. Dafür bin ich dann hin und wieder zu dem Vierbeiner in die Hütte gekrochen, drückte ihn fest an mich und versuchte, ihn mit meinem Körper zu wärmen. (Aber ich fror mehr als der Hund!)
Die Hunde hatten Flöhe, was keiner besser merkte als ich, schien ich doch jeden Floh magisch anzuziehen. Egal, ob zu Hause oder in der Bahn oder sonst irgendwo: Gab es irgendwo einen Floh, hatte ich ihn bestimmt bald im Umschlag meiner „Knöchelsöckchen“ sitzen. Die kleinen Plagegeister bevorzugten von den Hunden besonders meinen schwarzen Dackel „Lumpi“, und so sah ich mich öfter gezwungen, die Flohbekämpfung in einer Wanne mit Lysollösung vorzunehmen. Das gefiel weder dem Vierbeiner noch den Flöhen. Letztere kamen an die Felloberfläche, wo ich sie zu „knacken“ versuchte. Meistens waren es ihrer aber so viele, dass ich ihnen nicht schnell genug den Garaus machen konnte. Und wenn sie erst einmal Zeit hatten, sich etwas zu erholen, retteten sie sich mit einem Sprung auf meine „Knöchelsöckchen“. Das war dann der Moment, an dem ich mich geschlagen gab und das Unternehmen abbrach - bis zum nächsten Versuch.
Viele gute Erlebnisse hatte ich mit meinem treuen Hund „Prinz“.
Er sah und hörte alles und war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Ich muss ihn auch als klugen „Hirtenhund“ und tapferen Rattenfänger loben. Letzteres bewies er, als wir eine Zeitlang von Ratten im Schweinestall belästigt wurden. Wie wohl alle Bauern hatte auch mein Stiefvater die Angewohnheit, vor dem Schlafengehen „ableuchten“ zu gehen, d.h. er ging mit der Laterne in der Hand durch alle Stallungen, schaute nach den Tieren und überprüfte den Verschluss der Türen. Der Hund ging stets mit und erwischte dabei so manchen ungeliebten Nager. An der Jagd auf Ratten beteiligten sich bald mehrere Personen, selbstredend auch ich. Da „Prinz“ nur Erfolg haben konnte, wenn es ihm ermöglicht wurde, schneller in die Schweinekoben zu gelangen als die Ratten in ihre Schlupflöcher, wurde nach folgender Strategie vorgegangen: Vor der Stalltüre Aufstellung genommen, Hund mit den Worten „Ratten, fass!“ scharf gemacht, Tür aufgerissen, mein Stiefvater mit der Laterne voran und die Koben ausgeleuchtet, wir schnell die entsprechenden Türen geöffnet, Hund rein und - Gequieke. Nun ja, die Schädlinge lernten schnell, wurden übervorsichtig und unsere Erfolgsquote infolgedessen geringer, sodass letztendlich doch mit Gift gearbeitet werden musste. Gut bewährte sich auch der Einsatz von ungelöschtem Kalk: ein Gefäß mit ungelöschtem Kalk, daneben ein Gefäß mit Wasser. Nachdem die Ratten von dem Kalk gefressen hatten, bekamen sie Durst und tranken von dem Wasser, was einen chemischen Prozess in Gang setzte: Der Kalk wurde im Magen gelöscht/„gebrannt“ und…
Wenn die Kühe im Rossgarten waren, hatten sie vor dem Hund großen Respekt; denn wenn sie nicht schnell genug spurteten, biss er ihnen in die Fersen. Sollten sie z.B. aus der hintersten Ecke der eingezäunten Weidefläche nach vorne zur Melkstelle kommen, brauchte man nur zu rufen: „Prinz, hol!“, und allein schon beim Anblick des sich nahenden Vierbeiners setzten sie sich in Bewegung und kamen angelaufen, manchmal zum Ärger meines Stiefvaters im Galopp, was seiner Meinung nach nicht gut für den Milchfluss war.
Mit den Katzen verhielt es sich so, dass man ihre Zahl ja nicht ins Unendliche anwachsen lassen konnte, was ich aber als Kind nicht einsehen wollte. Die „Geburtenkontrolle“ bestand nun darin, die Neugeborenen in der Scheune oder auf dem Heuboden aufzustöbern, bevor sie die Augen geöffnet hatten - was meistens in der 2. Lebenswoche geschieht -, dann rein in einen Sack, mit einem Stein beschwert und ab in die Mitte des Teiches des nahen Rossgarten (wenigstens nicht des Hausteiches!). Man versuchte natürlich, solche Aktionen vor mir geheim zu halten, doch gelang das nicht immer. Traute war wachsam! Und wie ich dann auch bat und bettelte, in diesem Punkt blieb mein mir doch sonst so wohlgesonnener Stiefvater hart. Da lief ich dann am Ufer hin und her und versuchte, das Bündel mit den jämmerlich schreienden Kreaturen aus dem Wasser zu fischen, doch meistens ohne Erfolg.
Da ich, die „Katzenmutter“, grundsätzlich um jedes Katzenjunge kämpfte, hatten wir schließlich 14 Tiere (oder gar mehr?). Anscheinend war das selbst den Katzen zu viel - können auch Katzen psychisch krank werden? -, denn sie fingen nun an, durch schlechte Manieren die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Normalerweise pflegten die Tiere ja beim Spüren eines bestimmten Bedürfnisses zur Tür zu laufen, wo sie schnell hinaus gelassen wurden. Doch jetzt plötzlich bevorzugten einige von ihnen die hinterste Wohnzimmerecke unter der Chaiselongue mit dem tief herunter hängenden Überwurf. Es war wie verhext: Unerwartet schossen sie auf dieses Ziel los - ich schreiend mit dem Besenstiel hinterher. Leider, leider ließen sie sich nur selten stoppen, weder von mir noch von sonst jemandem. Ich will nicht näher ins Detail gehen. Jedenfalls machten sie sich äußerst unbeliebt, vor allem bei den Dienstmädchen, die ja die „Hinterlassenschaft“ wegzuputzen hatten. So wurden sie aus dem Haus verbannt, d.h. sie bekamen zwar noch in der Küche oder im Flur ihr Fressen - Essensreste oder in Milch eingeweichtes Brot -, aber dann ab in den Hof mit ihnen! Nun, es ging ihnen in den Stallungen nicht schlecht. Sie bevorzugten den Kuhstall, weil es dort am wärmsten war und der Schweizer ihnen nach jedem Melkvorgang gegen den Willen meines Stiefvaters frisch gemolkene Kuhmilch in ein Schüsselchen schüttete. Er schätzte sie als gute Mäusefänger, die ihm seiner Meinung nach den Stall und den darüber liegenden Heuboden frei von unappetitlichem Mäusekot hielten.
Meine Brüder züchteten allerlei Getier wie Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster. Im Sommer bauten sie für sie große „Freigehege“ aus Maschendrahtzaun, doch währte das Glück nie lange. Die eifrigen Nager, vor allem die Kaninchen, buddelten sich unterirdische Gänge, durch die sie ins Freie gelangen konnten. So mussten sie leider, leider immer wieder recht bald in ihre Kutzen/Käfige gesperrt werden. - Woher die Tiere ursprünglich stammten und wohin sie auch wieder verschwanden, weiß ich nicht. Die Buben durften in diesem Punkt recht eigenständig handeln. Geschäfte, Tauschgeschäfte mit anderen Buben?
Die einzigen Tiere, die bei uns vernachlässigt wurden, bis sich mein Bruder Herbert ihrer annahm, waren die Tauben. Tauben gehörten zwar auf jeden Bauernhof, wurden aber von meinem Stiefvater nach dem Nützlichkeitsprinzip als eher schädlich eingestuft, fraßen sie doch tüchtig Getreide aus dem Hühnertrog und pickten auf dem Feld die frisch ausgesäten Samenkörner auf, während sie wenig zur Ernährung beitrugen. Unsere Tauben hatten ihre Behausung in der allerhöchsten Giebelspitze des Wohnhauses über den beiden sich im Obergeschoss befindlichen Zimmern für Gäste und Dienstmädchen. Es handelte sich um einen großen, hellen Raum mit Fenster und Öffnung für die Abflugstange. Im Mittelbereich konnte man sogar aufrecht stehen. Als Herbert die Tauben unter seine Fittiche nahm, beschaffte er sich auch (durch Tauschhandel mit anderen Jungen?) ein paar besonders hübsche Ziertauben. Es war eine echte Freude, sie auf dem Dach zu beobachten. Selbst mein Stiefvater schien Gefallen an ihnen zu finden.
An sonstigem Federvieh hatten wir natürlich Hühner, Gänse, Enten und Puten, deren Anzahl sich im Laufe des Krieges beträchtlich vergrößerte. Denn Gänse, Enten und Puten waren der einzige Nutztierbestand, der nicht von den Behörden zwecks Ablieferung oder Erteilung einer Schlachtgenehmigung erfasst wurde, und auch die Anzahl der Hühner war nur zur Festsetzung der abzuliefernden Eier von Bedeutung. Und hier ergab sich außerdem die Möglichkeit, ein bisschen zu schummeln. Denn da es bei der großen, auf dem ganzen Gehöft frei herumlaufenden aktiven Hühnerschar unmöglich war, jedes einzelne Huhn zu zählen, konnte deren Zahl nur geschätzt werden, und diese Schätzung beruhte auf der Vorgabe des Besitzers. Nun, der amtliche Schätzer war einem durchaus wohlgesonnen, und so … Natürlich mussten Grenzen eingehalten werden, um niemanden in Schwierigkeiten zu bringen.
Das Federvieh diente uns nicht nur uns als zusätzliche Nahrungsquelle, sondern war auch während der Kriegsjahre für die mit Nahrungsmitteln knapp gehaltenen Städter ein hoch geschätztes Mitbringsel. Außerdem eignete es sich als Tauschobjekt oder zum „Schmieren“. So konnte mitunter eine mit einem bratfertigen Huhn/Hähnchen gefüllte Tasche plötzlich einen Gegenstand unter dem Ladentisch hervorzaubern, dessen Vorhandensein zuvor in Abrede gestellt worden war.
Wir besaßen ausschließlich weiße „Leghorn“-Hühner. Das ist eine zwar leichtere, aber dafür sehr legefreudige Hühnerrasse, die als anspruchslos in der Haltung und als gute Futtersucher und Futterverwerter bekannt ist. Für den Nachwuchs sorgten früher ausschließlich auf Eiern brütende Glucken, doch mit dem Fortschritt und dem größerem Bedarf ging meine Mutter dazu über, Eintagskücken zu bestellen. Was für eine Freude, wenn diese kleinen Flauschbällchen eintrafen! Als Ersatz für die fehlende Glucke diente ein auf niedrigen Beinen stehender, großflächiger Grude-Ofen (Anmerkung: Grude/Koksklein brennt nur glimmend und erzeugt mäßige, lang anhaltende Wärme), unter dem die Kleinen Schutz und Wärme suchen konnten. Zur weiteren Aufzucht hatte mein Stiefvater ein beheizbares, hölzernes Hühnerhaus auf Kufen bauen lassen, das mit Hilfe von Pferden an jeden beliebigen Ort gezogen werden konnte. Als Abschreckung gegen Raubvögel thronte auf dem Dach ein sich im Wind drehendes, knarrendes Gebilde, während der Auslauf durch feingliedrigen Maschendraht gegen Raubtiere abgesichert war. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen lagen ab einem bestimmten Zeitpunkt immer wieder kleine Flaumfederchen auf dem Boden herum, so dass sich mein Bruder Herbert mit seinem Tesching auf die Lauer legte. Er staunte nicht schlecht, als er das „Raubtier“ entdeckte: Es handelte sich nicht etwa um einen Marder, einen Iltis oder ein Wiesel, sondern um eine unserer zahlreichen Katzen, die damit - zum Schutz der Küken - ihr Leben verspielt hatte.
Die kalte Jahreszeit war die Zeit der Gestopften / Genudelten Gänse und Enten, wobei die Ausdrücke „gestopft“ oder „genudelt“ die Art der Mast beschreibt. Die dafür ausgesuchten Gänse und Enten wurden ein paar Wochen vor dem Schlachttag in einen engen Verschlag gesperrt und so ihrer Bewegungsfreiheit beraubt. Denn sie sollten ja in möglichst kurzer Zeit viel Fett ansetzen, das wir später zu Schmalz ausgelassen sowohl zum Braten als auch zum Ausbacken von Fettgebäck wie Krapfen (Berliner) oder „Weiberohren“ (bizarr geformte Küchelchen aus einem Knetteig) anstelle des heutigen Öls benutzten. Gänse- oder Entenschmalz mit Schweineschmalz vermischt ergab übrigens einen sehr gefragten Brotaufstrich. Neben einem stets reichlich gefüllten Futtertrog bestand die eigentliche Mast aus der Zufütterung von fingergroßen N u d e l n (Klößen), die man den Tieren mehrmals am Tag mit Gewalt in den Hals s t o p f t e . Sie wurden also gestopft bzw. genudelt. Die letzte Mahlzeit erfolgte spät am Abend, damit sie auch gut ansetzte. Die Nudeln bestanden aus zerdrückten gekochten Kartoffeln und grobem Mehl und wurden stets auf Vorrat hergestellt. Für diese arbeitsintensive Arbeit - Teig durch einen Fleischwolf mit Rohraufsatz gedreht, in ca. 5 cm lange Stücke geschnitten und zu glatten „Nudeln“ gerollt - wurden alle Hände gebraucht. So fand die Aktion stets abends in der Küche statt, wo alle mithelfen mussten. (Nur mein Stiefvater war entschuldigt.) Die fertigen Nudeln ließ man auf Zeitungen ausgebreitet trocknen und feuchtete sie vor dem Verfüttern leicht mit Wasser an, damit sie besser die Kehle hinunterrutschten. In ihrem engen Verschlag konnten die Tiere dieser für sie sicherlich schmerzhaften Zwangsernährung nicht entkommen. Man klemmte sie sich einfach zwischen die Knie, zwang sie mit der einen Hand, den Schnabel zu öffnen und stopfte mit der anderen Hand die Nudel hinein. Einen Tag vor ihrem Tode durften sie noch einmal in die Freiheit, aber auch nur, um sich im Teich das Gefieder zu reinigen, das man ja später als Füllung für Federbetten verwenden wollte.
Eine andere schmerzhafte Aktion war die Kastration männlicher Schweine in den ersten acht Tagen nach ihrer Geburt, um im Fleisch die Bildung des ungeliebten Ebergeruchs zu verhindern. Es wurde ohne Betäubung vorgegangen: Ferkelchen von einer Person hochgehoben, auf den Rücken gedreht, die Hinterbeinchen auseinander gespreizt gehalten, während mein Stiefvater die betreffenden Geschlechtsteile mit einem Rasiermesser ausschnitt. Ferkelchen ohne jede Schmerzmittelnachbehandlung zurück auf den mit Stroh bedeckten Zementboden gesetzt. Hätte der Tierschutzverein hier nicht einschreiten müssen? So unglaubhaft es klingt, eine chirurgische Kastration männlicher Ferkel o h n e Betäubung war selbst bis Ende des Jahres 2018 noch erlaubt. Erst ab dem 1. Januar 2019 musste ein Verfahren angewandt werden, das Schmerzen wirksam ausschaltet. (So war es jedenfalls vorgesehen. Auch durchgeführt?)
Sehr belastet hat es mich auch, wenn der Wurf einer Muttersau mitunter größer als die Anzahl ihrer Zitzen von normalerweise 14 war, so dass mindestens eines der Ferkelchen beim Andrang auf die lebenserhaltende Nahrungsquelle leer ausging. Hierbei handelte es sich natürlich stets um das kleinste und schwächste Geschöpf, das von den größeren und kräftigeren abgedrängt wurde. Zwar versuchte meine Mutter in solchen Fällen, es an eine der Zitzen zu hängen oder ihm ein Fläschchen zu geben, doch inmitten der viel vitaleren Geschwisterschar hatte es einfach keine Chance zu überleben und gab bald völlig entkräftet auf. Auslese der Natur.
Der ganze Stolz meines Stiefvaters galt außer Pferden unseren wohlgenährten, leistungsstarken Rindern, stand doch im Kreis Insterburg - wie in ganz Ostpreußen - nicht nur die Pferde-, sondern auch die Rinderzucht in voller Blüte, was auf die erfolgreiche Arbeit von Zuchtgesellschaften zurückzuführen war. So hatten wir in Insterburg u.a. den „Insterburger Herdbuchverein“ für das schwarz-weiße Tieflandrind , das, leistungsfähig und gesundheitlich robust, die Grundlage unserer erfolgreichen Viehzucht bildete. Der „Herdbuchverein“ beriet nicht nur in Fragen der Zuchtwahl, Aufzucht und Fütterung, sondern sorgte darüberhinaus für die Bekämpfung von Tierseuchen, vor allem der Tuberkulose. So konnte man bei uns selbst kuhwarme Milch ohne vorherige Aufbereitung gefahrlos zu sich nehmen. Wie viele Bauern im Kreis Insterburg waren auch wir Mitglied in dieser Züchtervereinigung.
Unser Vieh war sogenanntes „Herdbuchvieh“, was bedeutete, dass jedes einzelne Tier nach zufrieden stellender Begutachtung und Vermessung in das „Herdbuch“ (Zuchtbuch mit Zusammenstellung beglaubigter Abstammungsnachweise von Zuchttieren) aufgenommen worden war. Beispielhaft für den „Insterburger Herdbuchverein“ waren die turnusmäßigen Leistungskontrollen der Kühe durch die sogenannte „Milchschmeckerin“.
Bei der „Milchschmeckerin“ handelte es sich um eine junge, sympathische Frau, die sich in regelmäßigen Abständen bei uns einfand, von einem Vormittag bis zum anderem blieb, um dann von uns zum nächsten Bauernhof mit „Herdbuchvieh“ gebracht zu werden. Sie wurde also im 24-Stundentakt weitergereicht, immer mit Pferdefuhrwerk, denn neben ihrem persönlichen Gepäck (für wie viele Tage wohl?) führte sie ja die notwendigen Arbeitsutensilien mit sich. Ihre Arbeit bestand u.a. darin, bei den beiden Melkvorgängen, abends und morgens, die Milchleistung jeder einzelnen Kuh zu dokumentieren und Milchproben zu entnehmen, um später deren Qualität festzustellen. Den Fettgehalt bestimmte sie z.B. mit Hilfe einer runden, flachen, mit der Hand betriebenen Zentrifuge, denn elektrischen Strom hatten wir ja nicht. Ob sie auch Blutproben analysierte, entzieht sich meiner Kenntnis. Mir imponierte es schon sehr, wie sie da in unserer Küche im weißen Kittel an ihren Geräten herumhantierte. (Vielleicht könnte man sie als Laborantin bezeichnen?)
Bei „Herdbuchvieh“ wurde natürlich auf gute Nachzucht Wert gelegt. So durften „Herdbuchtiere“ nicht von den eigenen, selbst aufgezogenen Stieren gedeckt werden, sondern nur von speziell für die Zucht als gut befundenen, gekörten Zuchtbullen. Dadurch sah sich mein Stiefvater gezwungen, auf den monatlichen Bullenauktionen in Insterburg eines dieser teuren Tiere zu ersteigern. Für kleinere Bauernhöfe hingegen war es wegen der hohen Kosten wirtschaftlicher, von einer Anschaffung abzusehen und statt dessen die Kühe gegen Entrichtung einer Deckgebühr von einem fremdem Bullen decken zu lassen. So kam es, dass die betreffenden Bauern aus Waldfrieden und der näheren Umgebung ihre Tiere zu uns brachten. Über den Deckvorgang musste Buch geführt und ein Zertifikat mit Stammbaum des Bullen ausgestellt werden.
Dieser Zuchtbulle war das einzige Tier auf unserem Hof, vor dem ich mich wirklich fürchtete. Es war so strotzend voll Saft und Kraft, dass es mühelos die normalen Ketten zerriss und selbst der „Schweizer“ (Melker) seine liebe Not mit ihm hatte. So bekam der Bulle einen Eisenring durch die Nasenlöcher gezogen und wurde mit zwei starken Ketten daran rechts und links an die feste Zement-Futterkrippe angebunden. Musste er irgendwo hingeführt werden, z.B. in den Hof zum Deckakt, dann nur mit Hilfe einer an dem Nasenring befestigten langen Eisenstange, weit ab vom Körper seines Begleiters. Trotzdem gelang es ihm zweimal, den armen Melker Reinhold unter seine Hufe zu bekommen. Glücklicherweise war der frei herumlaufende Hund „Prinz“ als Retter zur Stelle, denn der Bulle hatte vor nichts und niemandem mehr Respekt als vor diesem Hund.
Wollte ich in den Kuhstall gehen, musste ich jedesmal an dem „Untier“ vorbei, hatte es doch seinen Platz gleich links neben dem Eingang. Ganz schlimm war es im Sommer. Denn da der Bulle wegen seiner Gefährlichkeit nicht mit den Kühen und Jungtieren in den Rossgarten gelassen werden konnte, musste er mutterseelenallein im warmen Stall ausharren und reagierte daher besonders gereizt. Sobald ich den Stall betrat, fing er sofort an, böse zu schnauben, mit den Ketten zu rasseln und mit den Füßen den mit Streu bedeckten Zementboden zu bearbeiten. Daher beeilte ich mich stets, so schnell wie möglich wieder herauszukommen. In einer Sommernacht gelang es diesem Koloss einmal sogar, der ganzen Familie einen gehörigen Schrecken einzujagen:
Nach einem Besuch bei unseren Nachbarn Burba, die in etwa 1 km Entfernung (Luftlinie) auf der Gemarkung Mittel-Werkau wohnten, benutzten wir für den abendlichen Heimweg wie gewohnt den Steig, der über die Felder führte und die kürzeste Verbindung zwischen den beiden Gehöften war. Dieser Steig war so schmal, dass wir im Gänsemarsch marschieren mussten: mein Bruder Herbert als erster, dahinter meine Mutter, mein Stiefvater, mein Bruder Egon und ich als letzte. Plötzlich tauchte vor Herbert etwas Großes, Dunkles, Bedrohliches auf. Auf dem engen Pfad - rechts ein Stacheldrahtzaun, links ein hohes Getreidefeld - kam uns bei hereinbrechender Dunkelheit unser Zuchtbulle entgegen, der sich zu Hause losgerissen hatte. Mein Bruder reagierte so geistesgegenwärtig, dass es mich noch heute erstaunt. Anstatt dem gewaltigen Tier nach links ins Getreidefeld auszuweichen, rannte er auf es los, laut „Prinz!“ „Prinz! “ rufend Der Bulle verharrte einen Augenblick, drehte sich dann aber um und lief den Weg zurück, Herbert mit seinem „Prinz“-Gerufe hinterher, wohl wissend, dass er ihn am Laufen halten musste. Und der Hund, der sicherlich auf unserer Auffahrt auf unsere Rückkehr gewartet hatte, hörte den Ruf und kam wie ein Blitz angesaust. Und so trieben die beiden den Stier im Galopp in den Stall zurück. Gerettet!
Wie bei der Rinder- und Schweinezucht war es auch bei der Pferdezucht ein Muss, die Stuten nur von gekörten Zuchttieren decken zu lassen. Doch der Erwerb und die Haltung eines dieser teuren Zuchthengste wäre selbst für unseren Hof unwirtschaftlich gewesen. So haben auch wir unsere Stuten zu der ca. 5 km entfernten Beschälstation/Deckstation nach Schackenau gebracht. Die Deckgebühr war erst nach vollzogenem Deckvorgang zu zahlen, denn es klappte durchaus nicht immer, was dann einen erneuten Versuch erforderlich machte.
Wie war es mit dem Reiten ? Natürlich sind wir geritten, jedoch nicht im klassischen Sinne. Es war ganz natürlich, schon als kleines Kind auf ein Pferd (normales Arbeitspferd oder Kutschpferd) gesetzt zu werden, mal mit, mal ohne Sattel. Ein Erwachsener führte den Vierbeiner solange am Zaumzeug, bis man ein Gefühl für das Reiten entwickelt hatte und die Grundregeln beherrschte. Ich erinnere mich sehr gut an meine erste Übungsstunde als etwa Vierjährige: Meine Mutter, mitten auf dem Hof stehend, ließ als erstes die geduldige Stute „Hilda“ solange an der Longe im Kreis traben, bis die sich etwas ausgelaufen hatte.
Dann hob sie mich auf den Sattel und drückte mir die Zügel in die Hände. Weiter siehe oben!
Wie auf dem Foto zu sehen, ließ die Körperhaltung zumindest bei mir sehr zu wünschen übrig, doch hat das meiner Freude keinen Abbruch getan. Bei unserem Reiten handelte es sich sowieso in erster Linie um eine nützliche Angelegenheit. So ritten wir z.B. die Pferde abends von der Koppel ohne Sattel nach Hause - zum Aufsteigen führten wir sie einfach an ein Holzgatter -, oder wir brachten sie nach Feierabend von dem Grundstück meines Stiefvaters in Tannenfelde nach Waldfrieden zurück, wenn bei der Feldbestellung Wagen und Ackergeräte für den folgenden Tag dort blieben. Ich bekam immer die lammfromme „Hilda“, die ich als „mein“ Pferd betrachtete. Wenn meine Brüder allerdings zum Galopp ansetzten, ging ihre Lammfrömmigkeit ganz schnell verloren. Dann galoppierte sie den anderen einfach hinterher, und ich, mal nach rechts, mal nach links rutschend, hatte Mühe, mich auf ihrem breiten Rücken zu halten. Mit einem Sattel war es nicht besser: Meine Beine waren einfach noch zu kurz.
An Sommerabenden wurden die Pferde zum Säubern und Abkühlen in einen unserer Teiche geritten, was man Schwemme nannte. Doch ich durfte dabei nicht mitmachen, bestand doch die Gefahr, unter ein sich wälzendes Ross zu kommen. Zu meinen Aufgaben gehörte es, auf dem Gaul sitzend Maschinen und Wagen zu fahren, die im Stop-and-Go-Verfahren eingesetzt wurden wie z.B. die Kartoffelmaschine beim Abernten eines nur kleinen Feldes oder beim „Weiterfahren“ des Erntewagens von einer Garbenhocke zur nächsten. So konnten die Knechte die Getreidebündel recht zügig auf den Wagen staken, wo sie ein bis zwei Mägde entgegennahmen und sachgerecht stapelten, damit das vollgeladene Gefährt beim Nachhausefahren nicht etwa Garben oder gar das Gleichgewicht verlor und umkippte. Da vor einen Erntewagen aber stets zwei Pferde eingespannt waren, zog ich es meistens vor, mit der Leine in der Hand nebenher zu gehen. Ich fand das alles recht unterhaltend, waren doch stets schwätzende Leute um mich herum. Ich war ja immer begierig, etwas aufzuschnappen, was ich sonst nicht zu hören bekam. Das Aufladen der Garben mit dem davor auf Mäuse lauernden Hund war zudem spannend: Ob wohl dessen Jagdeifer beim Hochheben des l e t z t e n Ährenbündels belohnt werden würde?
Was ich hasste, war, eine hochtragende Stute auszureiten. Sie müsse bewegt werden, hieß es, und wegen meines geringen Gewichtes sei ich am besten dafür geeignet. Ich hasste das, weil die Tiere das hassten. Oft blieben sie zum Verschnaufen stehen und wollten nicht weitergehen. Von mir dann energisch angetrieben, wurden sie bockig und machten unerwartet einen großen Satz, der mich abzuwerfen drohte. Das war aber alles nichts gegen die bösen Erfahrungen, die ich mit einem als Reitpferd gekauften Wallach machte:
Da ein gutes Reitpferd kein gutes Arbeitspferd sein kann und die Anschaffung zudem verhältnismäßig teuer war, sahen die meisten Bauern von der Haltung eines reinen Reitpferdes ab. So ist mir in Waldfrieden (Ostp.) nur das Reitpferd des Gutsbesitzers Ernst Lörchner aus Weidlauken in Erinnerung, das wohl meinen Stiefvater dazu angeregt haben mag, uns, wenn schon nicht ein ausgebildetes Reitpferd, so doch wenigsten eine Remonte zu besorgen und deren weitere Ausbildung selbst zu übernehmen. (Remonte: Ein sich in der klassischen Reitkunst oder bei der Kavallerie noch in seiner Grundausbildung befindliches Pferd.) Eine günstige Gelegenheit bot der in Insterburg (Garnisonstadt, Gestüt, großer Reitplatz) in Abständen abgehaltene „Remontenmarkt“ des Militärs, auf dem Remonten versteigert wurden. Es handelte sich da mitunter um Tiere mit einer Macke, einen durch falsche Behandlung erworbenen Charakterfehler. So hatte der Wallach, den mein Stiefvater dort erwarb, die unangenehme Angewohnheit, auszuschlagen und zu beißen. Nun, mein Stiefvater traute sich zu, ihm diese Unarten durch geschickte Maßnahmen abzugewöhnen und aus ihm ein gutes Reitpferd zu machen, was leider nicht ganz gelang. Bei ihm verhielt es sich zwar friedlich, doch für andere war beim Umgang mit ihm äußerste Vorsicht geboten, besonders für mich. Wissend, dass ich mich ihm nicht von hinten nähern durfte, habe ich das gar nicht erst versucht, aber auch meinen sonstigen Annäherungsversuchen stand er abgeneigt und äußerst bissfreudig gegenüber. Oh, dieses böse Gesicht, wenn er die Ohren anlegte und die Zähne bleckte! Trotz all meiner Achtsamkeit gelang es ihm mehrmals, mich am Arm oder in die Schulter zu beißen, meistens hinterrücks, wenn ich mich bereits zum Gehen umgewandt hatte. Für die Knechte war es ebenfalls schwierig, ihn zu versorgen und zu bürsten und zu striegeln. Beklagten sie sich, meinte mein Stiefvater nur, sie verständen nicht, ihn zu behandeln. Auf jeden Fall hatte ich bald einen bösen Schimpfnamen für ihn parat: „Pisswallach“.
Mein schlimmstes Erlebnis mit diesem Stinker war folgendes: Als etwa Siebenjährige hatte ich mir beim Nacheifern meiner Brüder bei ihren Fahrradkunststückchen eine so tiefe Wunde am Knie zugezogen, dass ich wegen Gehunfähigeit nicht zur Schule gehen durfte. Nach drei bis vier mir endlos erscheinenden Tagen zu Hause kam man auf die Idee, ich könne ja zur Schule reiten. Also auf ein Pferd gesetzt - natürlich auf meine gutmütige „Hilda“ - , und ab ging’s! Bruno, ein junger Zigeuner aus dem „Schuppinner Bruch“, der als Pferdejunge bei uns arbeitete, lief nebenher, um den Vierbeiner nach Hause zurückzuführen und ihn mir zum Schulschluss wieder zu bringen. Und wen brachte er mir da? Ausgerechnet den „Pisswallach“ !
Es war um die Osterzeit, die unbefestigten Landstraßen nach der Schneeschmelze total aufgeweicht, an schattigen Stellen hier und da noch ein schmutziger Schneerest. Bruno half mir in den Sattel und drückte mir die Zügel in die Hand - da warf ein Mitschüler einen Schneeball nach dem Pferd, das scheute und ging mit mir durch, der Pferdejunge schreiend hinterher.
Vor Schreck lasse ich die Zügel fallen, versuche krampfhaft, mich an der Mähne und dem Sattelknauf festzuhalten, rutsche mal nach der einen, mal nach der anderen Seite - der Sattel ist ist so glatt und die Steigbügel viel zu lang! - , schaue auf den 15 - 20 cm tiefen Morast unter mir und stellte mir vor, wie „weich“ ich da wohl landen würde, und das mit dem kranken Bein! Wir nähern uns der Abzweigung zu unserem Hof, Panik packt mich, glaube ich doch, der wildgewordene Gaul würde geradeaus weiter rennen - mein Gott, wohin wohl? Da steht mein Vater an der Hofeinfahrt und pfeift - und mein Reittier fällt in einen ruhigen Schritt und biegt friedlich und wie selbstverständlich in den Weg nach Hause ein. In Sicherheit! (War da vielleicht nach all den ausgestandenen Ängsten so etwas wie eine kleine Enttäuschung über diesen so unspektakulären Ausgang, wollte ich meinem Stiefvater doch bittere Vorwürfe wegen dieses Pferdes machen - und natürlich bedauert werden?)
Unangenehme Erinnerungen habe ich auch an das „Pferde halten“. An und für sich fuhr ich gerne mit meinem Stiefvater nach Aulowönen (Aulowönen klingt mir viel vertrauter als Aulenbach). Es war richtig anheimelnd, neben ihm unter der Pelzdecke oder der zugeknöpften Plane zu sitzen. Die Pferdchen trabten munter drauflos, und er sang mir Kinderlieder vor oder gab einige seiner unzähligen Vers’chen oder Bibelzitate zum besten. Die Aulenbacher Geschäftswelt war auf die Pferdefuhrwerke eingestellt und hatte an ihren Läden Vorrichtungen zum Anbinden der Pferde anbringen lassen. Bei Rautenberg gab es zusätzlich ein frei stehendes Gebäude, so eine Art Schuppen, wo man die Pferde mitsamt dem Gefährt unterstellen konnte. Davon wurde hauptsächlich bei sonntäglichen Kirchbesuchen (dann meistens mit Kutscher), Festen oder bei schlechtem Wetter Gebrauch gemacht. Doch wenn mein Stiefvater in den Geschäften nur kurz etwas zu erledigen hatte, ließ er mich einfachhalber die Pferde halten. Das war mitunter eine Plage, denn die wohlgenährten Vierbeiner wollten nicht still stehen und strebten dem Heimweg zu, so dass ich kleines Mädchen die größte Mühe hatte, sie unter Kontrolle zu halten.
Einmal, als wir auf dem Weg nach Hause an Goetz (Kolonialwarengeschäft mit Gastwirtschaft) vorbeikamen, erregten ein paar vor dem Gebäude stehende Fuhrwerke die Aufmerksamkeit meines Stiefvaters, konnte er doch an Hand der ihm bekannten Fahrzeuge auf deren Besitzer schließen, die entsprechend den örtlichen Gewohnheiten in der Gastwirtschaft in geselliger Runde beisammen saßen. Goetz hatte ja wie jedes Kolonialwarengeschäft mit Gastwirtschaft ein bis zwei Gaststuben, wo die Herren nach Erledigung ihrer Geschäfte reinzuschauen pflegten, um auf Freunde oder Bekannte zu stoßen und ein Bier oder einen Schnaps zu trinken. Nun, bei einem Bier oder einem Schnaps ist es selten geblieben, denn sobald einer der Herren eine Tischrunde „schmiss“/ausgab, war es für die anderen Ehrensache, es ihm gleichzutun. Und manchmal begann alles noch einmal von vorne, aber wohl kaum wegen des Alkohols, sondern wegen der Geselligkeit. Auf jeden Fall verspürte mein Stiefvater den Wunsch, den Herren da drinnen mal schnell „Guten Tag“ zu sagen. So ließ er mich das Pferd unseres leichten Einspänners halten und eilte mit den Worten:„Ich bin gleich wieder da!“ in den Laden. Ich wartete und wartete, doch er kam nicht. Fakt war, er hatte sich bei Goetz festgesetzt, in einer Gruppe ihm wohlgesonnener und anscheinend wichtiger Personen, währenddessen ich die sonst so brave Stute zu halten versuchte, die jetzt aber wegen ihres inzwischen prall gefüllten und daher schmerzenden Euters unbedingt nach Hause zu ihrem Fohlen wollte und den leichten Einspänner gegen meinen Willen immer wieder in Richtung Heimat drehte. In meiner Verzweiflung schickte ich durch einen Passanten einen Hilferuf in die Gastwirtschaft. Da erschien mein Stiefvater höchst aufgeräumt auf der Treppe und versprach, gleich zu kommen, doch leider zog sich dieses „gleich“ sehr in die Länge.
Das war das letzte Mal, dass ich Pferde gehalten habe. Wurde ich ihn Zukunft gefragt, ob ich mitfahren wollte, war meine prompte Erwiderung: „Wenn ich die Pferde halten muss: NEIN!“ Und ich ließ mich auch nur ein einziges Mal überlisten. Danach war ich immer die erste, die schon während des Anhaltens vom Wagen sprang und sich außer Reichweite brachte, um nicht doch noch die Zügel in die Hand gedrückt zu bekommen.
Auto
In Waldfrieden gehörten wir mit zu den ersten und später auch zu den wenigen, die ein Auto besaßen. Als mein Stiefvater 1936 nach Erwerb einer DKW Schwebeklasse einen Führerschein benötigte, musste er für die Fahrstunden extra bis nach Insterburg fahren und später dort die Fahrprüfung ablegen. Der motorisierte Verkehr war noch schwach, denn bei unseren Touren in die Kreisstadt begegneten wir auf der 17 km langen Strecke kaum anderen Autos. Auf jeden Fall waren wir glücklich, das Auto zu besitzen und genossen die damit neu gewonnene Mobilität. So war es jetzt nicht mehr schwierig, die Oma mütterlicherseits im Kreis Darkehmen zu besuchen oder Freunde der Familie in Kreis Angerapp oder Verwandte in Königsberg . Das Auto stand parat!
Leider war es um die Straßenverhältnisse rund um Waldfrieden schlecht bestellt. Die asphaltierte Hauptverbindungsstraße von Insterburg über Aulenbach nach Tilsit lief nämlich in einer Entfernung von ca. 2 km an Waldfrieden vorbei, und außer einer Kies-Chaussee, die vom Moorbad Waldfrieden zum Dorf Waldfrieden und weiter über Tobaken und Schackenau / Schacken zu dieser Asphalt-Chaussee führte, waren alle Straßen unbefestigt und dem entsprechend bei Nässe (Regen und Schnee- schmelze) schwer oder kaum befahrbar. Dazu gehörte natürlich auch der Weg von unserem Gehöft (Abbau) zum Dorf und somit zu dieser Kies-Chaussee. So passierte es mehr als einmal, dass mein Stiefvater auf dieser Strecke mit dem Auto stecken blieb und sich von einem Pferdegespann abschleppen lassen musste. Manchmal ließ er vorsichtshalber gleich zu Hause zwei Pferde vor das Auto spannen und sich ins Dorf ziehen. Wir waren es gewohnt, mit schwierigen Situationen umzugehen.
Die Freude an unserem Auto währte leider nur ein paar Jahre, wurde es doch während des Krieges durch Beschlagnahme aller vier Räder stillgelegt und stand danach aufgebockt in der Tannenfelder Scheune herum. Der Kraftstoff wurde dringend für die Kriegsmaschinerie gebraucht. Natürlich gab es auch Sondergenehmigungen wie zum Beispiel für das Moorbad Waldfrieden , das ja ein Auto brauchte, um die Kurgäste vom Bahnhof abzuholen und bei der Abreise wieder hinzubringen.
Erbhof, Anerbenrecht
Durch das Reichserbhofgesetz von 1933, das die Höfe bei der Erbaufteilung vor Zerstückelung und Überschuldung schützen sollte, wurden alle landwirtschaftlichen Besitzungen zwischen 7,5 und 125 ha zu einem Erbhof erklärt und dessen Eigentümer als Bauer, alle anderen dagegen als Landwirt bezeichnet. Ein Erbhof durfte weder veräußert, verkleinert, noch belastet werden und hatte nach dem Anerbenrecht ungeteilt auf einen einzigen Erben, den Anerben überzugehen. Die Rechte der Miterben richteten sich nicht mehr nach dem Wert des Grundstücks, sondern beschränkten sich auf das sonstige Vermögen des Bauern, das nach Tilgung etwaiger Schulden übrig blieb. Der älteste Sohn wurde zum Anerben bestimmt, doch musste dieser bauernfähig (deutsche Staatsangehörigkeit, keine Geisteskrankheit) und ehrbar sein (keine Neigung zur Trunksucht oder Verschwendung) und durfte unter seinen Vorfahren kein jüdisches oder farbiges Blut haben (musste also „arisch“ sein, ein Begriff, der damals immer wieder benutzt wurde).
Unser Anwesen war also per Gesetz ein Erbhof und mein ältester Bruder Herbert der Anerbe, der als solcher seine Abstammung an Hand einer beglaubigten Ahnentafel nachzuweisen hatte.
Um auf seine zukünftige Aufgabe gut gerüstet zu sein, durfte er die Landwirtschaftsschule in Insterburg besuchen und danach als Volontär/Gutseleve Berufserfahrungen auf einem großen Gut sammeln. Seine Zukunft schien also gesichert zu sein, hatte er doch auch die passende Freundin gefunden - nennen wir sie Inge -, eine höchst ansprechende Bauerntochter aus Staggen , die das nötige Know How mitbrachte und ihm gewiss einmal als tüchtige Bäuerin zur Seite stehen würde.
Doch es kam anders: Eines Tages wurde das Reichserbhofgesetz dahingehend geändert, dass nicht mehr der älteteste, sondern der jüngste Sohn der Anerbe war. Die Idee war sicher nicht schlecht, denn dadurch hatten die Eltern länger Zeit, noch etwas für die übrigen Kinder/die weichenden Erben zu erwirtschaften, bevor sie ihren Besitz an den Anerben übergaben. Das Reichserbhofgesetz bedeutete ja nicht, dass der Anerbe erst nach dem Tod der Eltern den Besitz e r b t e , sondern ihn schon zu deren Lebzeiten übereignet bekam, und zwar früh genug, um noch eine eigene Familie gründen zu können. So galt bei uns plötzlich nicht mehr mein ältester Bruder Herbert, sondern sein jüngerer Bruder Egon als Anerbe/Hoferbe. Und Herbert? Würde er nun etwa seine Inge gar nicht heiraten können? Er war ja jetzt ein Jungbauer ohne Land, und ihr stand der Erbhof ihrer Eltern (86 ha) als Zweitälteste von vier Töchtern ebenfalls nicht zu. Den Gedanken, den beiden ein Grundstück zu kaufen, konnte man gleich verwerfen, denn selbst mit dem nötigen Eigenkapital wäre das kaum möglich gewesen, waren doch alle landwirtschaftlichen Anwesen von entsprechender Größe (s.o.) als Erbhof eingestuft und somit unveräußerlich und unteilbar. Ich muss hier an ein Volkslied denken, das ich etwas umdichten will:
- "Es waren zwei Bauernkinder,"
- "die waren einander sehr gut."
- "Sie konnten zusammen nicht kommen,"
- "denn sie hatten weder Land noch Gut."
Wie sahen nun Herberts Zukunftsaussichten aus? Es bestand zwar die Möglichkeit, auch nach Übertragung des Hofes auf den jüngeren Bruder in Waldfrieden zu bleiben, doch wäre das natürlich keine Grundlage für eine Eheschließung mit Inge gewesen. So hätte er wohl wie andere in seiner Lage irgendwann, irgendwo auf eine Einheirat warten/hoffen müssen, wahrscheinlich bei einer verwitweten Bäuerin, da die weiblichen Familienmitglieder ja durch die Erbfolgeordnung des Reichserbhofgesetzes stark benachteiligt waren und erst durch eine 1943 erfolgte Gesetzesänderung den Status einer Erbhofbäuerin erlangen konnten. Solche Junggesellen in Wartestellung hatte es ja schon v o r dem Reichserbhofgesetz gegeben und war durchaus nichts Ehrenrühriges. Ich denke da u.a. an Mosels und Schüsslers aus Waldfrieden und Krügers aus Groß Warkau. Dass es noch mehr Heiratsanwärter dieser Art gab, erlebten wir hautnah nach dem frühen Unfalltod meines Vaters (1932).
Trotz der drei Kinder war meine Mutter (34 J.) eine heiß begehrte Witwe, bot unser Grundstück doch eine ideale Einheirat. Es kam soweit, dass sie auf keine Veranstaltung mehr ging, weder sonntags ins Moorbad, noch zu Rautenberg oder Goetz in Aulenbach, noch zu Haeskes in Mittel-Warkau. Denn stets näherte sich ihr jemand, der sie unbedingt mit dem Bruder irgendeines Hoferben verheiraten wollte - sich einen „Kuppelpelz“ verdienen, nannte man das. In unserem Bekanntenkreis gab es einen Heiratskandidaten, der über mich Einfluss auf meine Mutter zu nehmen versuchte. So wählte er jetzt für seine Fahrten nach Aulenbach den für ihn weiteren Weg, der an unserem Gehöft vorbeiführte, und verharrte vor unserer Auffahrt solange mit seiner Pferdekutsche, bis ich Vier- bis Fünfjährige neugierig zu ihm hingelaufen kam. Er ließ mich jedesmal ein Stück auf seinem schmucken Fahrzeug mitfahren und versprach, mir auf dem Rückweg Schokolade mitzubringen. So lauerte ich dann auf sein Zurückkommen und konnte es nicht verstehen, dass meine Mutter sich so gar nicht mit mir über die Mitbringsel freute. (Aber verboten wurde mir das Hinlaufen nicht, hat man doch stets versucht, alles Belastende von uns Kindern fernzuhalten. So haben wir zum Beispiel auch nie unsere Eltern oder Großeltern in unserer Gegenwart streiten gehört.)
Meine Mutter lehnte diesen Kandidaten hier wie alle anderen ab. Konnte sie sicher sein, für ihre Kinder einen wirklich guten Stiefvater zu bekommen? Saßen ihr einige dieser Herren vielleicht zu oft im Krug/in Gastwirtschaften herum? Es war dann letztlich meine Oma, die in die Rolle der erfolgreichen Ehevermittlerin schlüpfte. Max Brandstäter stammte zwar nur von einem kleinen Grundstück in Tannenfelde mit ursprünglich 9,81 ha - ehemals mit Windmühlenbetrieb, der aber im Zuge der Industrialisierung durch die Inbetriebnahme der mit Strom betriebenen Mühle Schiemann in Aulowönen als nicht mehr rentabel eingestellt worden war. Denn die Bauern nahmen nun ihr Getreide auf ihren Fahrten ins Kirchdorf mit, wo sie es jederzeit unabhängig von Windverhältnissen gemahlen bekamen und das Mehl gleich wieder nach Hause mitnehmen konnten. - Der Vater war bereits Ende des 1. Weltkriegs an der damals herrschenden „Spanischen Grippe“, einer Influenza-Pandemie, gestorben. Sohn Max war auf eine Einheirat nicht angewiesen, denn von den acht Kindern war er es, der den elterlichen Hof mit Altenteil für die Mutter und der Verpflichtung, seine Geschwister auszuzahlen, übernommen hatte. Letztere waren bereits verheiratet und außer Haus. Das Grundstück hatte seit seiner Übernahme schon an Wert gewonnen. So hatte er 1931 von Gutsbesitzer Lörchner in Weidlauken 5,25 ha Ackerland dazu gekauft (Anliegersiedlungskredit) und von den noch mit Stroh gedeckten Gebäuden bereits die Scheune und einen Stall durch Neubauten ersetzt. Dabei kam ihm zugute, dass er sich nach einer Maurerlehre selbständig gemacht hatte und als Bauunternehmer tätig war. Einer seiner Brüder hatte Schlosser gelernt und sich danach dank der Mitgift seiner Ehefrau eine große, gut florierende Schlosserei in Königsberg aufbauen können. Ein anderer wiederum war Bahnbeamter auf dem Insterburger Großbahnhof. Warum diese detaillierte Aufzählung? Nun, weil zu dem Thema Handwerkerlehre anzumerken ist, dass sie in unserem damaligen Klassendenken für Söhne von größeren Bauernhöfen wie z.B. dem unseren als nicht s t a n d e s g e m ä ß galt.
Zwei Eigenschaften Max Brandstäters, meines späteren Stiefvaters, waren für meine Mutter am wichtigsten:
1. Er war sehr kinderlieb und kam bei allen Kindern gut an. So wollte mir am Hochzeitstag sogar meine Cousine Ursel meinen Platz auf seinem Schoß streitig machen. Letztendlich saßen wir beide bei ihm: sie auf einem Oberschenkel, ich auf dem anderen.
2. Er war weder ein Trinker/Säufer, noch ein übermäßiger Raucher. Er trank und rauchte ausschließlich in Gesellschaft und auch das nur in Maßen, was deshalb erwähnenswert ist, weil man in Ostpreußen dem Alkohol durchaus nicht abgeneigt war. In einem Kinderlied aus den zwanziger Jahren hieß es u.a.: „Wir versaufen unserer Oma ihr klein Häuschen, ihr klein Häuschen, und die erste und die zweite Hypothek.“ Auch der Ausspruch: „Er hat das Grundstück versoffen!“ ist mir in Erinnerung.
Doch zurück zu Herbert! Es kam alles anders: Egon , der mit 18 Jahren als Freiwilliger zur Waffen-SS gegangen war, fiel im April 1942 in Russland, kurz vor seinem 19. Geburtstag. Herbert, nun wieder der Anerbe, wurde auf Antrag meiner Mutter als „letzter Sohn und Hoferbe“ vom Wehrdienst zurückgestellt. Das war gewiss keine einfache Situation für ihn, gab ihm doch das Umfeld das Gefühl, er müsste doch eigentlich… wo doch alle diensttauglichen Männer in Feindesland kämpften und bereit waren, ihr Leben für Führer, Volk und Vaterland zu lassen… Mit fortschreitendem Krieg war es fast eine Schande, zwischen all den Uniformierten in Zivilkleidung herumzulaufen und nicht wenigstens ein EK II (Eisernes Kreuz zweiter Klasse) zu tragen, wenn nicht schon ein EK I oder gar ein Ritterkreuz wie jener Offizier aus Groß-Warkau, von dem mit größter Hochachtung gesprochen wurde.
Eines Tages galt das Rückstellungsgesetz nicht mehr. Hitler brauchte auch die letzten Söhne. So wurde Herbert doch noch eingezogen. Meine Mutter und ich besuchten ihn zweimal, einmal in Tilsit, ein oder zwei Tage, bevor er als Infanterist nach Russland ausrückte, das andere Mal in Schlesien, wo er im Lazarett Schwarzenberg bei Oppeln seine Verwundung auskurierte. Diese Fahrt brachte uns zum ersten mal in unserem Leben über die Grenzen Ostpreußens hinaus, und das im Krieg als „Selbstversorger“ und bei total überfüllten Zügen. Oft schaffte uns nur unser mit Lebensmitteln wie gebratenen Enten prall gefüllter, überdimensional großer Koffer Platz: ihn mit vereinten Kräften hochgehievt und ohne Rücksicht auf die schon im Eingangsbereich dicht bei dicht gedrängt stehenden Fahrgäste reingeschoben, wir hinterher - und der Schaffner drückte die Tür von außen zu.
Herbert konnte schon am Stock gehen, war jedoch vom Krieg gezeichnet und sehr ernst und bedrückt. Beim Spaziergang durch den Schlosspark lenkte er gleich am ersten Tag unsere Schritte so, dass wir wie zufällig auf ein nettes, junges Mädchen stießen, das er uns als eine Bekannte aus dem Dorf vorstellte. Sie war Verkäuferin in einem sehr guten Herrenmodegeschäft in Oppeln. Ihre Eltern besaßen ein nettes Häuschen in Schwarzenberg, wo Herbert freundliche Aufnahme gefunden hatte. Auch wir wurden eingeladen, bei welcher Gelegenheit ihr Cousin voll auf mich abfuhr und davon schwärmte, mich in Ostpreußen zu besuchen. Oh, nein! Es war ein Schock für meine Mutter, erkennen zu müssen, das Herbert plante, dieses Mädchen einmal zu heiraten. Eine Verkäuferin als Bäuerin?? Sie versuchte, ihm höchst eindringlich und wiederholt klarzumachen, dass er eine B ä u e r i n brauche, die einen Hof führen könne, und keine Verkäuferin, egal, wie nett und anziehend sie auch sei. Und ich? Ich fand sie toll in ihrer e i g e n e n Umgebung, aber als Schwägerin in Ostpreußen wünschte ich sie mir nicht. Was würden wohl die Nachbarn zu einer Verkäuferin sagen! Und erst Inge! Denn die war es doch, die ich und meine Familie nur zu gerne als Herberts Frau gesehen hätten! Konnte er ihr denn ihren Treuebruch nicht verzeihen? Sollte dieses Mädchen hier tatsächlich ihre Nachfolgerin werden? Die Story:
Inge war im Laufe des Krieges dienstverpflichtet, als Krankenschwester ausgebildet und dann in Holland eingesetzt worden. Eines Tages kam dann die Schocknachricht, sie habe sich in Holland mit einem Stabsarzt verlobt. Wie tief das meinen Bruder verletzt haben muss, erfuhren wir erst einige Zeit danach. Die Verlobung war nämlich nicht von Dauer, und so wollte sie sich Herbert wieder zurückholen. Sie kam auf Urlaub, mein Bruder und ich - ich nach damaliger Sitte als Anstandswauwau - wurden zu ihnen nach Hause eingeladen. Doch so sehr sie sich auch um ihn bemühte, er ging auf ihre Annäherungsversuche nicht ein. So war unsere nächtliche Heimfahrt im Schlitten durch die verschneiten Dörfer mehr als bedrückend. Auf mein ständiges Drängen sagte er schließlich, er wolle kein Lückenbüßer sein.
Zurück nach Schwarzenberg: Es war schon beachtlich, dass es gerade ihm von den vielen Verwundeten im (Schloss-)Lazarett gelungen war, dieses wirklich nette Mädchen für sich zu gewinnen. Aber meine Mutter ließ nicht locker und nahm ihm das Versprechen ab, diese Bindung zu lösen. Dass er sich nicht danach gerichtet hatte, erfuhren wir erst nach seinem Tode, als sich das Mädchen bei meiner Mutter nach seinem Wohlbefinden erkundigte, da sie schon längere Zeit keine Post mehr von ihm erhalten hätte. Solche Anfragen waren damals durchaus üblich und bedeutete ja in fast allen Fällen: gefallen oder vermisst. Und so war es auch hier: Herbert war am 20. Juli 1944 mit noch nicht ganz 23 Jahren auf dem Rückzug in Italien gefallen. Von uns benachrichtigt, schickte sie ein herzliches Beileidsschreiben mit einem Trockengesteck zum Gedenken an ihn.
Nach dem Tode meiner beiden Brüder blieb nur ich als Erbin unseres Erbhofes übrig.
Kriegsgefangene und Zwangsarbeiterinnen
Ohne Erwähnung der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiterinnen wäre mein Bericht nicht vollständig. Denn es waren ja polnische und französische Kriegsgefangene, die die vakanten Stellen der während des Krieges zur Wehrmacht einberufenen deutschen Arbeitskräfte füllten, und es waren Zwangsarbeiterinnen/zwangsrekrutierte Mägde aus Polen und Weißrussland (?), die die deutschen Dienstmädchen teilweise ersetzten oder bei ihrer Arbeit unterstützten.
Besonders gut erinnere ich mich an unser erstes Polen-Mädchen. Statt eines „Untermenschen“ (Nazi-Propaganda!) erschien da ein gepflegtes, gut gekleidetes neunzehnjähriges Stadtkind aus Warschau, offensichtlich wohl behütet und abgöttisch geliebt von drei älteren Brüdern. Wanda, so war ihr Name, hatte bis zu ihrer „Zwangsverschickung“ nach Ostpreußen nichts anderes zu tun gehabt, als die kranke Mutter zu pflegen. Nun wurde sie ausgerechnet mit harter Arbeit auf einem Bauernhof konfrontiert. Sie verging fast vor Heimweh und Sorge um die Mutter. Eines Tages bekam sie ein beglaubigtes Telegramm der Brüder: die Mutter läge im Sterben, sie solle sofort nach Hause auf Urlaub kommen.
Tatsächlich gab es 1940 noch die Möglichkeit, in einem solchen Falle ausnahmsweise auf Urlaub zu fahren. Allerdings bedurfte es dazu der schriftlichen Freistellung durch den Arbeitgeber und dessen Garantie für die Rückkehr der Beurlaubten. Meine Mutter zeigte viel Zivilcourage, als sie Wanda für abkömmlich und in Bezug auf das Wiederkommen für glaubwürdig erklärte - gegen den Willen der Behörden und Nachbarn, die Nachahmungen befürchteten. Wanda, sie hatte ihr ganzes Hab und Gut mitgenommen, kehrte n i c h t zurück. Die Behörden und Nachbarn erwarteten nun von meiner Mutter, sie als unabkömmlich anzuzeigen, was in Warschau eine Hetzjagd auf sie ausgelöst hätte. Meine Mutter tat es nicht.
Um kein einseitiges Bild zu zeichnen, muss ich dieser Geschichte eine andere entgegen stellen, die sich ein einige Jahre später zutrug und ebenfalls aus dem üblichen Rahmen fiel. Es handelte sich wiederum um eine polnische Zwangsarbeiterin, die aber absolut nichts von Wandas Flair hatte, sondern eher unansehnlich und niedergeschlagen wirkte. Als ich einmal unerwartet die Mägdekammer betrat, überraschte ich sie mit Tränen im Gesicht betend (katholisch) vor ihrem Bett knien. Sie schien großen Kummer zu haben. Wie sich dann bald herausstellte, war sie schwanger. Und der Vater? Ein polnischer oder französischer Kriegsgefangener? Konnte es etwa sein, wie mir die anderen einzureden versuchten, dass sie mit Absicht schwanger geworden war, um nach den geltenden Richtlinien nach Polen zurück geschickt zu werden? Meine Mutter jedenfalls wollte sie nicht behalten und brachte sie zum Arbeitsamt zurück. Doch wie der Zufall so spielt: Ein paar Monate später begegnete sie ihr noch einmal, und zwar im Insterburger Krankenhaus, wo die nun Hochschwangere die Treppen putzte. Anscheinend waren die Richtlinien für Schwangere geändert worden.
Mit den polnischen Kriegsgefangenen verhielt es sich in der ersten Zeit so, dass sie in einer vergitterten und des Nachts bewachten Sammelunterkunft untergebracht waren, morgens von einem Wachmann mit umgehängtem Gewehr zu ihren Arbeitsstellen gebracht und abends wieder abgeholt wurden. In Waldfrieden befand sich diese Sammelunterkunft auf dem Gut Lörchner/Weidlauken. Wie die Räumlichkeiten aussahen und wieviele Kriegsgefangene dort untergebracht waren, konnte ich leider von den beiden bei uns beschäftigten Polen nicht in Erfahrung bringen. Die Sprachbarriere war einfach zu hoch. So hatte auch mein Stiefvater Schwierigkeiten damit, ihnen seine Wünsche und Arbeitsanweisungen verständlich zu machen. Anfangs ging es oft nicht anders, als ihnen neben Einsetzung von Mimik und Gebärden erst einmal vorzumachen, was und wie sie etwas tun sollten, z.B. ein Pferd aufschirren und vor einen Wagen spannen, zumal beide aus der Stadt stammten.
Später durften die polnischen Kriegsgefangenen ganz bei ihren Arbeitgebern wohnen, aber auch dort in einem Raum mit vergittertem Fenster und des Nachts verschlossener Tür. Da traf es sich gut, dass mein Stiefvater die üblicherweise in eine Ecke des Pferdestalls integrierte Knechtekammer durch einen Anbau an der Rückseite des Stallgebäudes ersetzt hatte. So konnte das der Hofseite abgewandte Fenster den Vorschriften entsprechend durch ein starkes Eisengitter abgesichert werden, ohne die gewohnte „Idylle“ des Hofplatzes zu zerstören (vergittertes Fenster = Gefängnis). Und das Abschließen der Tür erledigte mein Stiefvater sozusagen im Vorbeigehen, wenn er wie gewohnt abends „ableuchten ging“. Die beiden Polen zeigten sich durchaus lern- und arbeitswillig und waren bemüht, den „Chef“ zufrieden zu stellen. Von den Nutztieren brauchten sie glücklicherweise nur die Pferde zu versorgen, da unser absolut zuverlässiger und erfahrener Schweizer/Melker Reinhold zu dem Zeitpunkt noch nicht eingezogen war. Denke ich an jene Zeit zurück, sehe ich zwei bescheidene, junge Burschen an unserem Küchentisch sitzen, die ich als etwa Elf-/Zwölfjährige dazu bewegen will, am Heiligen Abend ein polnisches Weihnachtslied zu singen, was sie jedoch nur zögerlich und sehr verhalten tun. Ich wollte nett zu ihnen sein, es war doch W e i h n a c h t e n , schien ihnen aber mit meinem Anliegen keinen Gefallen getan zu haben.
Die Knechtekammer war groß genug, um darin später auch die sechs französischen Kriegsgefangenen unterzubringen, die die polnischen ablösten. Man hielt es anscheinend für sinnvoller, die letzteren überwiegend weiter westwärts einzusetzen, um ihnen eine etwaige Flucht zu erschweren. Die französischen Kriegsgefangenen wurden im Allgemeinen mehr geachtet als die polnischen und dementsprechend besser behandelt. (Tendieren wir nicht generell mehr nach Frankreich als nach Polen?) So gab es in Insterburg eine Dienststelle für sie, die sich um ihre Belange kümmerte und sogar ihre Beschwerden (!) entgegennahm, stets mit dem Wachmann als Mittelsmann. Was mich am meisten überraschte, war die Anteilnahme, die man offensichtlich auch in den USA an ihrem Wohlergehen nahm, erhielten sie doch von dort für sie bestimmte Pakete - Care Pakete? - , überwiegend mit Schokolade gefüllt, mit der sie sich dann abends in der Küche „heiße Schokolade“ zubereiteten, und das in einer Zeit, in der wir in Deutschland keine Schokolade (Kolonialware = Ware aus den K o l o n i e n ) mehr zu kaufen bekamen. Also, um dieses Schokoladengetränk habe ich die Franzosen schon beneidet, nicht aber um die Spatzen, die sie sich in Nähe unseres Hühnerstalls (Körner!) mit Hilfe einer Kutze/Drahtkäfig fingen und dann abends gerupft und ausgenommen auf unserem Herd brieten. Ich fand es barbarisch, diese kleinen Viecher zu schlachten und als Delikatesse zu verspeisen.
Die französischen Kriegsgefangenen zeigten sich sehr anstellig und versorgten nicht nur die Pferde, sondern auch das Vieh (Milchkühe), war doch unser „Schweizer“ inzwischen Soldat geworden. Da bei den Franzosen wegen der weiten Entfernung zu ihrem Heimatland keine Fluchtgefahr bestand, konnten sie sich in Waldfrieden und Umgebung weitgehend frei bewegen und somit auch außerhalb unseres Grundstücks ohne deutsche Begleitung eingesetzt werden. So waren sie öfter allein mit einem unserer Fuhrwerke unterwegs, brachten z.B. die Milch zur Milchsammelstelle ins Dorf, holten Rollgüter vom Bahnhof ab, fuhren Ackergerät zum Grundstück meines Stiefvaters nach Tannenfelde oder vollgeladene Getreidewagen von dort zurück, kutschierten mich manchmal zum Bahnhof oder holten mich abends von der Haltestelle in Buchhof ab, wenn ich erst mit dem Abendzug von Insterburg (Schule) nach Hause kommen konnte.
Einer der Kriegsgefangenen spielte sehr gut Akkordeon, wir nannten ihn „Musikus“. An Sommerabenden hockte er oft vor dem Pferdestall und spielte seine berührenden Chansons, während ein oder zwei seiner Kameraden vor dem Fenster der Mägdekammer mit den Polinnen/Weißrussinnen schäkerten. Unvergesslich diese ostpreußischen Sommerabende, wenn leichter Nebel über dem Hausteich aufstieg, die Frösche quakten, die Grillen zirpten und vollkommener Friede über dem Land lag!
Doch die ostpreußische Idylle endete im Sommer 1944 mit dem verheerenden Luftangriff auf Insterburg und dem Bau des „Ostwalls“, zu dessen Schanzarbeiten auch die französischen Kriegsgefangenen herangezogen wurden. Von einem Einsatz der polnischen Kriegsgefangenen wurde abgesehen, da man befürchteten musste, dass diese die günstige Gelegenheit zur Flucht ergreifen würden. Inwieweit konnte man ihnen überhaupt noch trauen, nachdem doch schon einer in Lindenhausen (4 km von Waldfrieden entfernt) seinen Arbeitgeber und dessen Ehefrau mit der Axt erschlagen hatte? (Meines Wissens nach war und blieb das aber nur ein Einzelfall.)
Dass mein Stiefvater nach dem Luftangriff auf Insterburg mit dem ausgebombten Ehepaar K. auch deren zwangsrekrutierte Weißrussin zu uns mitbrachte, erwies sich keineswegs als Glücksfall, war doch dieses Mädchen das erste und einzige, dass es wagte, „aufmüpfig““ zu werden und negatives Gedankengut zu verbreiten, was sich mit der Zeit mehr und mehr verstärkte. So zeterte sie z.B. bei der Kartoffelernte lauthals herum, was das überhaupt noch solle, das hätte doch alles keinen Zweck mehr (Russe), sie würde sich nur ihre Kleidung schmutzig machen. Sicherlich hatten die vielen Zwangsarbeiter in der Stadt bessere Informationsquellen (Abhören von Feindsendern) als die verstreuten auf dem Land und wussten daher besser als wir, was es mit dem „planmäßigen Rückzug“ der deutschen Wehrmacht wirklich auf sich hatte. Doch zu ihrer wohl verständlichen Genugtuung kam auch die Angst, von den eigenen Soldaten als Kollaborateure erschossen oder verschleppt zu werden. Immer öfter beobachtete ich, wie die „Aufmüpfige“ auf unsere beiden Weissrussinnen einredete und ihnen u.a. von geheimen Aufrufen berichtete, in denen es hieße, durch ihre Arbeit für die Deutschen würden sie helfen, den Krieg zu verlängern. Sie sollten die Arbeit sabotieren.
Daher war es wie eine Befreiung, als das Ehepaar K. zu ihrer Tochter nach Danzig zog und meine Eltern die zurückgelassene „Aufmüpfige“ dem Arbeitsamt zur Weitervermittlung übergeben konnten. Doch leider sollten sich deren Unkenrufe nur zu schnell erfüllen. Unsere Zeit in Waldfrieden neigte sich ihrem Ende zu. In einigen der nach der Evakuierung Waldfriedens leerstehenden Häusern hausten jetzt polnischen Zwangsarbeiter (Bahnarbeiter und Leute vom sogenannten „Dreschkommando“), die sich Abend für Abend mit den polnischen und französischen Kriegsgefangenen sowie den polnischen und weißrussischen Zwangsarbeiterinnen in Hallers großer Küche trafen. Auch unsere Franzosen und Weissrussinnen nahmen an diesen Zusammenkünften teil. Wer kann es ihnen verdenken, dass sie in dieser so beängstigend ungewissen Zeit die Nähe Gleichgesinnter suchten und das Zusammensein bei den Akkordeonklängen u n s e r e s „Musikus“ sichtlich genossen? Ja, ich habe mich einmal in Hallers Küche gewagt, doch war mein Besuch beklemmend kurz: Bei meinem Eintritt verstummte jedes Gespräch, erstarrte jede Bewegung. Ich war hier und jetzt unerwünscht!
Am 19. Januar 1945 gingen wir dann auf die Flucht. Im vorderen Wagen saßen meine Eltern und ich, in den beiden nachfolgenden fünf unserer französischen Kriegsgefangenen und die beiden Weißrussinnen, die erstaunlicherweise mit uns westwärts zogen. Der 6. Franzose war dem verzweifelten Hilferuf unserer Nachbarn Burba (Mutter mit zwei Töchtern) gefolgt, deren polnischer Kriegsgefangener (oder Zwangsarbeiter?) sich abgesetzt hatte.
Die letzten Monate vor der Flucht 1945
Von den wirklichen Schrecken des Krieges sind wir bis zum Frühsommer 1944 verschont geblieben. Zwar flogen in Waldfrieden hin und wieder ein paar feindliche (russische?) Flugzeuge über uns hinweg, ohne jedoch nennenswerten Schaden anzurichten. Mitunter fiel da etwas auf unsere Felder herab, doch waren das an kleinen Fallschirmen befestigte Blechbehältnisse die, da schon leer, keinerlei Gefahr für den Finder bedeuteten, ihn aber mit einem Stück weißer Fallschirmseide beglückten. Zwar waren die Stücke nicht groß, doch hatte ich bis Ostern 1944 so viel Seide zusammen, dass mir unsere einfallsreiche Hausschneiderin daraus ein sehr hübsches Konfirmationskleid nähen konnte, und das ein einer Zeit, in der man selbst auf Bezugscheine kaum noch etwas zu kaufen bekam.
Wie schon eingangs erwähnt, im Frühsommer 1944 endete die ostpreußische Idylle. Der Feind näherte sich Ostpreußens Grenzen, die Fliegerangriffe auf Insterburg wurden stärker, und am 14. Juli erfolgte die Bombardierung der Stadt:
Es ist eine taghelle Sommernacht. Alle Bewohner unseres Hofes stehen auf dem freien Feld hinter unserer Scheune, wo uns keine Bäume die Sicht auf den vom Feuerschein erleuchteten Horizont versperren. Wir sehen und hören die britischen (anglo-amerikanischen?) Bomber über uns hinweg fliegen. Plötzlich erfasst mich panikartige Angst, dass man uns bei der Helligkeit erkennen könnte, und ich laufe Hals über Kopf ins Haus - wohin nur? - in den K a r t o f f e l k e l l e r . Doch nur zu bald wird mir bewusst, dass ich hier unten, mutterseelenallein in dem dunklen Raum mit den hochangelegten Fensterluken, durch die ich nie hinaus käme, wirklich in der Falle sitze, denn dieser Raum ist ja alles andere als ein sicherer Luftschutzkeller, geschweige denn Luftschutzbunker! Nichts wie raus hier! Ich renne ich zu den anderen aufs Feld zurück. Immer neue „Christbäume“ werden gesetzt (Leuchtkugeln, die minutenlang in der Luft schweben und den Angriffsflugzeugen als Zielmarkierung voraus fliegen)… Wie es wohl um unsere Verwandten in Insterburg stehen mag?
Am folgenden Morgen fährt mein Stiefvater sofort in die Stadt und sieht das Ausmaß der Zerstörung. Aber gottlob, die Verwandten leben, ihre Häuser sind nicht getroffen worden. Doch als er das ihm bekannte Ehepaar K. vor ihrem zerbombten Besitz für landwirtschaftliche Maschinen stehen sieht, lädt er es samt Dienstmädchen, einer zwangsrekrutierten Weißrussin, auf sein Pferdefuhrwerk und bringt sie mit einem Teil ihrer Habe zu uns nach Hause mit. Meine Mutter ist nicht gerade „amused“/erfreut, denn wir haben das Haus schon voll. Dieses Weißrussenmädchen ist übrigens das erste und einzige, das es wagt, „aufmüpfig“ zu werden. Ich werde von ihr noch an anderer Stelle berichten.
Nein, Ostpreußen ist nicht mehr eine sichere Oase. Daher werden die „bombenevakuierten Berliner“ wieder „zurück evakuiert“: Mutter und Tochter reisen ab. Die Flüchtlingstrecks der Baltendeutschen und Memelländer ziehen auf dem Weg nach Westen an unserem Hof vorbei. Sie scheren nicht aus der endlosen Kolonne aus, und wir nehmen keinen Kontakt zu ihnen auf. Die Front nähert sich unaufhaltsam, was wir jedoch nicht überblicken können. Wir haben keine Ahnung von dem Zustand der deutschen Truppen, keine Ahnung von der Überlegenheit des Feindes. Gott sei Dank! Denn Ostpreußens Gauleiter Erich Koch, von Hitler zum Verteidigungskommissar für unser Gebiet ernannt, gibt keineswegs den Befehl zur Räumung, sondern zum Bau von Panzergräben, Schützengräben und Bunkern an der nördlichen Grenze Ostpreußens, dem sogenannten „Ostwall“. Dazu werden alle Männer bis zum 60. (65.?) Lebensjahr zu Schippkolonnen zusammengestellt, und so lässt auch mein Stiefvater Spaten, Schaufeln, Pickeln und dergleichen auf einen Wagen laden und fährt mit fast allen französischen Kriegsgefangenen in Richtung Litauen ab. Ich erinnere mich an mir fröhlich zuwinkende HJ-Jungen in Uniform, die in einem vollen Zug auf dem Bahnhof Waldfrieden an mir vorbeifahren - ebenfalls ostwärts.
Unheimlich: Plötzlich ist das Land von allen deutschen Männern und Hitler-Jungen wie leergefegt. Nur ein paar französische Kriegsgefangene hat man zur Versorgung der Haustiere zu Hause gelassen. Auf die polnischen Kriegsgefangenen ist bei dieser Schaufelaktion verzichtet worden, musste man doch befürchten, sie könnten die Gelegenheit zur Flucht ausnutzen. Und gerade diese Polen sind es, die das Gefühl des Verlassenseins verstärken. Können wir vor ihren Racheakten sicher sein? Einer von ihnen hatte schon zugeschlagen, und zwar in dem etwa vier km entfernten Lindenhausen seine Arbeitsgeber, das Ehepaar Kuprat, mit der Axt umgebracht. (Bei den Erschlagenen handelt es sich um Schwager und Schwägerin von Tante Minna Rieck, der Schwester meines Stiefvaters).
Meine Mutter schläft mit geladenem Revolver auf dem Nachttisch. Auch ich lasse mir den Mechanismus erklären, stelle mich jedoch zu dumm an. Dafür inspiziere ich unser Wohnhaus auf dessen Sicherheit und bin entsetzt: Die beiden Eingangstüren sind zwar aus solidem Eichenholz, doch sehen die Schieber am Boden des zweiflügeligen Gästeeingangs schon stark abgenutzt aus, während mir der Riegel an der Tür zum Küchentrakt viel zu schwach erscheint. Einem gewaltigem Schlag/Tritt würden meines Erachtens wohl beide nicht standhalten. Und die Fenster, in unserer Gegend ohne Fenster- oder Rollläden, vergrößern nur mein Unbehagen. Kann man uns etwa von draußen durch die zugezogene Gardine beobachten? - Ich bekomme Albträume.
Am 20. Juli erfahren wir von dem Attentat auf Adolf Hitler. Der 20. Juli ist auch der Todestag meines Bruders Herbert, gefallen in Italien, noch nicht ganz 23 Jahre alt.
Meine tieftraurige Mutter will von nun an nur noch Schwarz tragen. Die Todesmeldungen reißen nicht ab: Ehemänner, Väter, Söhne, Brüder, Verlobte, Freunde - es gibt kaum eine Familie, die nicht mindestens einen Toten zu beklagen hat. Wie sehen die Todesanzeigen aus? Da liest man mitunter von s t o l z e r T r a u e r über den so heldenhaft für Führer und Vaterland Gefallenen. Meistens heißt es aber nur „In stiller Trauer“, denn Formulierungen wie „sehr erschüttert“, „für uns alle unfassbar“, „viel zu früh aus dem Leben gerissen“ oder „tief betroffen“ entsprechen nicht dem Zeitgeist und werden besser vermieden, so schwer es auch fallen mag.
Wie kurz ein Soldatenleben mitunter sein kann, erlebe ich durch meine kaum begonnene Korrespondenz mit einem netten Jungen aus Ernstwalde, den ich, nachdem er die Mittelschule in Insterburg beendet hatte, nur noch gelegentlich im Zug oder bei HJ-Veranstaltungen traf. Als er 1944 eingezogen wurde, wünschte er sich wie viele blutjunge Soldaten Kontakt zu einer B r i e f - f r e u n d i n zu bekommen, war doch für die Soldaten an der Front der Erhalt bzw.Austausch von Briefen überaus wichtig, sozusagen als Verbindung zur Heimat. Seine Wahl fiel auf mich. Dem ersten Brief legte er den Gepflogenheiten entsprechend ein postkartengroßes Porträt-Foto bei, das ihn als Soldat zeigte. Falls ich die Brieffreundschaft nicht ablehnte, hatte auch ich ihm ein Porträt-Foto zu schicken, ebenfalls in Postkartengröße. Also auf zum Fotografen! Doch mein Brief erreichte ihn schon nicht mehr und kam ungeöffnet zurück: Der Adressat war bereits bei den Kämpfen an den Grenzen Süd-Ostpreußens gefallen. Mutig sei er seinen Kameraden vorangestürmt, las ich Jahre danach in einem Bericht seines Vaters.
Ich zitiere: „Am 20. August geht ein russischer Spähtrupp östlich von Schillfelde über den Grenzfluss Scheschuppe. Der Krieg erreicht Ostpreußen.“ Wer Ostpreußen verlassen darf, tut es. So fahren „unsere Wuppertaler“ wieder nach Hause zurück. Sie waren seit November 1943 bei uns. Aus Insterburg schafft man zuerst die Alten und Kranken weg. Selbst nach der offiziellen Evakuierung im Oktober 1944 hat die arbeitende Bevölkerung bis zuletzt auf ihrem Posten zu bleiben, so auch Onkel Emil Brandstäter als Bahnbeamter. (Ich greife vor: Bei einem Fliegerbombardement wird ihm am 21. Januar 1945 - zwei Tage nach unserer Flucht - auf dem Stellwerk des Insterburger Großbahnhofs ein Bein abgerissen. Er kommt buchstäblich mit dem letzten Zug nach Westen. So auch Waltraud Borchert, Tochter des Bademeisters aus dem Moorbad Waldfrieden, die ebenfalls in Insterburg dienstverpflichtet war. Zumindest ab dem 22. Januar 1945 ist jeglicher Zugverkehr nach dem Reich gesperrt.)
Und wir? Zwischen Bangen und Hoffnung hin- und hergerissen, überwiegt auch jetzt die Hoffnung. Was versprechen wir uns nicht alles von der „Wunderwaffe“! Seit September ist nun die V 2 im Einsatz gegen England (V = Vergeltungswaffe). Ach, was haben wir doch in der Pension Hauptmann, in der ich mit fünf anderen auswärtigen Schülerinnen „in Pension“ war, den Abschussbeginn der V 1 bejubelt!
In Waldfrieden bleiben wir selbst in dieser Zeit nicht ohne Gäste. Diesmal sind es Soldaten. Es ist kaum zu glauben, dass Angehörige jener Einheit, die vor 3 ½ Jahren vor dem Russlandfeldzug bei uns im Quartier lag, ein Militärauto voller geschlachteter Schweine und ein Dutzend lebender Gänse auf unseren Hof bringen, mit der Bitte, das Fleisch räuchern zu dürfen und das Federvieh gefüttert zu bekommen: alles in Polen auf dem Rückzug requiriert. Ein Feldwebel, ein gelernter Fleischer aus Hamburg, soll mit einem Gefreiten bei uns bleiben und die Räucherei übernehmen. Meine Eltern sagen wie üblich nicht „nein“ (ostpreußische Gastfreundschaft), und so wird das Fleisch tüchtig eingesalzen und in großen Wannen und Holzbottichen in dem kühlen Besucherflur gelagert. Von da an arbeitet unsere Räucherkammer auf Hochtouren.
Und ich bekomme einen Hund in Obhut, einen echten Pekinesen, den ein Offizier beim Bekämpfen des „Warschauer Aufstandes“ von der Straße mitgenommen hat. Die Einheit liegt nun irgendwo an der Grenze Süd-Ostpreußens im Dreck, wo der kleine Vierbeiner mit seinen bodenlangen Haaren schlecht existieren könnte. Ich bin hell begeistert, doch nur für kurze Zeit. Denn auch unsere Straßen sind aufgeweicht und nichts für dieses verweichlichte Schoßhündchen, das immer recht bald beängstigend nach Luft schnappt. Was bin ich froh, dass das Tier wider Erwarten schon nach acht Tagen abgeholt wird - die Front hat sich verschoben.
Mitte Oktober brechen die Russen auf breiter Front über die ostpr. Grenze südlich von Gumbinnen ein und überrennen Nemmersdorf (ca. 50 km von Waldfrieden entfernt). Die Gräueltaten von Nemmersdorf sind bekannt. Im Laufe der Oktober-Kämpfe fallen Städte, die sich von uns in einer Entfernung von 50-70 km Luftlinie befinden. Doch es gelingt der deutschen Wehrmacht, die durchgebrochenen Russen abzuschneiden und an der Rominte eine neue Abwehrfront einzurichten. Die Russen behalten Tilsit, Trakehnen und Ebenrode in ihrer Hand, stellen aber den Vorstoß nach Westen ein. Erst am 12. Januar 1945 greifen sie wieder an.
Würde die ostpreußische Zivilbevölkerung jetzt im Oktober 1944 in den Westen evakuiert werden, würde ihr viel Schlimmes erspart bleiben. Doch was geschieht? Waldfrieden erhält zwar mit anderen Dörfern den Räumungsbefehl, aber nicht für den Westen, sondern für das ca.15o km entfernte, zwischen Elbing und Allenstein in Ostpreußen gelegene Mohrungen! Und geographisch gesehen sind wir der letzte Ort, der evakuiert werden soll. Bereits das westlich von Waldfrieden liegende Nachbardorf Schuppinnen muss/kann/darf bleiben. Also kann die Lage doch nicht so aussichtslos sein! Wir glauben nur allzu gerne das Gefasel von der deutschen Unüberwindbarkeit und der Wunderwaffe, obgleich der Russe fast schon vor unserer Haustüre steht. Unser so naiver Glaube erspart uns den Weg nach Mohrungen, denn mein Stiefvater beschließt, sich dem Treck n i c h t anzuschließen. Seine Begründung: Wenn es tatsächlich zur Flucht käme, könnten wir ebenso gut mit dem Nachbardorf mitziehen.
(Diese so verrückt anmutende Entscheidung erweist sich dann im Januar 1945 als richtig, wenn auch anders, als gedacht. Der Russe stößt mit zwei Fronten vor, die eine auf Königsberg, die andere auf Elbing gerichtet, und so ist er in Mohrungen so schnell wie in Waldfrieden. Insterburg und Allenstein fallen am gleichen Tag ( 22.Januar 1945). Wir haben den Vorteil, mit Pferd und Wagen auf die Flucht gehen zu können, während sich einige unserer Nachbarn in Mohrungen zu Fuß auf den Weg machen müssen, da sich ihre Gespanne auf dem Weg nach Waldfrieden zum Drescheinsatz befinden.)
Dass mein Stiefvater dem Evakuierungsbefehl nicht nachkommt, wird behördlicherseits nicht gern gesehen. Und so sollen wir keine Lebensmittelkarten erhalten. Der für die Ausgabe zuständige Ortsvorsteher in Schuppinnen sagt ihm am Telefon, nach seinen Unterlagen existierten wir überhaupt nicht mehr. Na, da solltet ihr einmal meinen Stiefvater hören! Die beiden Männer kennen sich gut und duzen sich, aber ein falsches Wort zu sagen, das als Kritik gegen die Parteiführung ausgelegt werden könnte, wäre trotzdem gefährlich, hier und jetzt wie überall zuvor. Herr Z. bleibt bei seinem „Nein“, mein Vater hält diplomatisch dagegen: „Die Traute fährt jetzt los und holt die Karten bei dir ab!“ Höchst ungern und mit beklommenem Herzen mache ich mich mit dem Fahrrad auf den Weg, doch zu meiner Überraschung hat Herr Z. die Karten schon bereitgelegt.
Wenn wir auch die Hoffnung auf ein gutes Ende noch nicht aufgegeben haben, treffen wir doch Vorbereitungen für die Flucht. So werden Kastenwagen mit einem halbrunden Holzgestell versehen und mit Planen überdeckt und durch im vorderen Teil des Wagens eingelegte Bretter Sitzbänke geschaffen. Beladen werden die Fahrzeuge mit vielen (30 Liter?) großen Milchkannen, vollgefüllt mit gebratenem oder gekochtem Schweine- oder Geflügelfleisch, das zur Haltbarmachung mit Schmalz übergossen worden ist. Ferner kommen geräucherter Speck und Schinken, Rauchwurst, Mehl und dergleichen auf die Wagen, wie auch Heu und Hafer für die Pferde. Die Ladung wird vervollständigt durch überzählige Decken und Oberbetten, halt mit allem, was nicht verkommt/verdirbt.
Dann geht es ans Vergraben von Dingen, die wir nicht mitnehmen können würden: gutes Geschirr, gute Bestecke, Weckgläser mit Marmelade, Obst und dergleichen. Die französischen Kriegsgefangenen haben zwischen dem Pferdestall und der Schmiede eine etwa 2,50 x 5 m große, tiefe Grube ausgehoben und eine Strohschicht als Unterlage hineingegeben. Darauf kommen aus den ehemaligen Baracken des Reichsarbeitsdienstes requirierte Spinde, die Rückwand nach unten, die Türen weit geöffnet, ich hocke davor und packe ein, was meine Mutter mir durch die Dienstmädchen bringen lässt. Die vollen Spinde werden mit Decken und Stroh abgedeckt. Darauf kommt Erdaushub mit sorgfältig abgestochenen Rasenstücken und zu guter Letzt halbverrottetes Stroh zur Tarnung.
Die besten Stücke an Tisch- und Bettwäsche, Handtücher und dergleichen werden in ein Vertiko gepackt und zu der Tochter des Ehepaars K. nach Danzig-Olivia geschickt. Als nächstes begeben sich meine Eltern zu Bekannten auf Quartiersuche, so für alle Fälle. Weit weg? Gott bewahre! Wozu auch? Der vordringende Feind würde bestimmt bald wieder zurückgeworfen werden, und wir können zurückkehren. Im 1. Weltkrieg war es doch auch so! Meine Eltern fahren also an einem Sonntag mit dem Pferdefuhrwerk nach dem nur 15 km entfernten Dorf Schirrau und machen dort Quartier. (Und tatsächlich wird das im Januar 1945 unsere erste Anlaufstelle werden.) Und meine Mutter lässt sich für alle Fälle einen Ausweis machen, der, wie das Foto zeigt, in damaliger Zeit aus einer recht primitiven Postkarte besteht:
„ Es wird hiermit bescheinigt daß das nebenstehende Bild Frau Ella Brandstäter aus Waldfrieden Kr. Insterburg ist. Sie ist am 1.1.98 zu Adl.- Kermuschinen geboren. Die Unter- schrift ist eigenhändig vollzogen.“
- Unterschrift, Stempel, H. Liebchen, Amtsvorsteher Lindenberg, d.19.11.44
- Ella Brandstäter
Übrigens, als meine Eltern auf Quartiersuche sind, bin ich nicht allein. Die beiden Soldaten mit der Räucherei von Schweinen leisten mir Gesellschaft. Irgendwie sind sie uns ein Schutz und mir darüberhinaus willkommene Gefährten in dieser von Schulkameradinnen und Freunden so losgelösten Zeit. Denn nach den Sommerferien ist der Schulbetrieb in Insterburg nicht mehr aufgenommen worden, was wir aber nur durch die Zeitung erfahren haben. Fröhlich sind wir im Juni nach Empfang der Zeugnisse auseinander gegangen, ohne Adressen austauschen, ohne zu ahnen, dass wir uns nicht mehr wiedersehen wer Hier in Waldfrieden ist meine Busenfreundin Hannelein mit ihrer Mutter zu einer Tante nach Elbing geflüchtet, die Jungen, die ich kenne, sind entweder Flakhelfer oder Soldat oder wie die schulentlassenen Mädchen irgendwo dienstverpflichtet. Und ob es in den verstreuten Dörfern noch ehemalige Fahrschülerinnen aus der Kleinbahn gibt, weiß ich nicht. Die Verbindung ist gänzlich abgebrochen.
Dass die Kartoffeln Anfang November noch nicht geerntet sind, beschreibt wohl am besten die Unsicherheit, in der wir leben. Nun jedoch, an einem zwar sonnigen, doch schon empfindlich kalten Spätherbsttag beschließt mein Stiefvater, sie doch noch einzubringen. Alle Mann aufs Feld! Auch die beiden Soldaten helfen fleißig mit. Ach, die Erde ist so nass, die Hände sind im Handumdrehen klamm und gehorchen kaum, und es fragt sich wohl jeder im Geheimen, wozu eigentlich noch die ganze Mühe!
Ja, es sieht trostlos aus. Neben dem Bahnkörper sieht man einen endlosen Zug von Rinderherden entlang trotten, teilweise apathisch vor Erschöpfung, teilweise brüllend vor Schmerzen wegen des übervollen Euters. Ein paar blutjunge Burschen gehen als Begleitung nebenher. Sie haben nichts bei sich als einen langen Stock und einen Stoffbeutel. Der Anblick dieser armen, hilflosen Tiere ist schwer zu ertragen. Aber mir tun auch die Jungen leid.
Noch einmal bekommen wir Besuch. Dieser Major Menke, der seinerzeit seine Oma zu uns in die „Winterfrische“ brachte, hat doch tatsächlich - ungefragt - seine hochschwangere Frau aus Wuppertal für einen gemeinsamen Urlaub bei uns anreisen lassen. Wir sind perplex! Dennoch stellen meine Eltern dem Paar gemäß ostpreußischer Sitte ihr eigenes Schlafzimmer zur Verfügung. Aber die junge Frau und werdende Mutter friert schrecklich und fühlt sich absolut unwohl bei dicken Federbetten, dürftiger Waschgelegenheit (Keramikschüssel und -kanne auf dem Waschtisch) und zugigem Plumsklo und reist glücklicherweise bald wieder ab. (Nein, ein Dankeschön werden wir nach dem Krieg nicht bekommen. Dieser Herr Major und seine Gattin hatten bei mir sowieso jede Sympathie verloren, nachdem sie sich weigerten, sich mit den Nicht-Offizieren an einen Tisch zu setzen, obgleich doch der Feldwebel und der Gefreite ebenfalls unsere Gäste waren. Aus Protest deckte ich für die beiden letzteren in der „guten Stube“, setzte mich demonstrativ zu ihnen und zündete entgegen unserer sonstiger Gewohnheit sogar eine Kerze an.)
Eines Nachts reißt uns schrecklicher Lärm wie von Panzern aus dem Schlaf. Vom Dorf her wühlen sich ein paar schwere Fahrzeuge durch die matschige Straße zu uns durch. Wir starren angstvoll in die stockdunkle Nacht und können außer der Beleuchtung nichts erkennen. Der Russe? Nein, noch nicht! „Unsere“ beiden Soldaten werden mit Sack und Pack abgeholt: Die Einheit wird verlegt. (Rückzug?) Geräucherte und noch nicht geräucherte Schinken, das Dutzend Gänse, alles wird schnell aufgeladen und dann nichts wie ab!
J e t z t fühlen wir uns w i r k l i c h einsam und verlassen. Außer dem Ehepaar Zerulla und Frau Burba mit zwei Töchtern (Gemarkung Mittel-Warkau) sind wir die einzigen Einheimischen in Waldfrieden. Zum Moorbad Waldfrieden, in dem ein Feldlazarett eingerichtet wird, hat es bis jetzt keinerlei Kontakt gegeben. Nachfolgende Auszüge aus einem Brief meiner Mutter an Frau Hüber, neun Tage vor unserer Flucht geschrieben, schildern unsere Lage: „…Gott sei Dank ist es uns noch immer vergönnt, hier in Waldfrieden zu sein. Auch wir haben still und mit wehem Herzen das Weihnachtsfest verlebt. Hier im Dorf gibt es nur unerfreuliche Neuigkeiten. Frau Szillat (Anm. nach Mohrungen evakuiert wie auch die übrigen) hat furchtbares Heimweh, und auch die anderen wären lieber daheim. Denn von Frau Haller ist alles Zurückgebliebene verschwunden, und auch Frau Fleiß und Frau Zwillus klagen sehr, daß vieles verschwunden ist. In den Wohnungen von Haller, Krink und Szillat hausen Polen (Bahnarbeiter und Dreschkommando). Im Moorbad wird ein Feldlazarett eingerichtet, und in Ihren Räumen (Anm.Schulhaus) hat der Oberarzt Quartier bezogen. Ihr Telefon (Anm. Öffentliches Telefon) ist nicht gesperrt, da es zur öffentlichen Benutzung freigegeben werden musste, und deshalb darf mein Mann die Tafel nicht entfernen. Zwecks Kräfteeinsparungen sollen die Telefonanlagen der übrigen Teilnehmer abgebaut werden…
Unsere Kleinbahn fährt nur Munition. Wir können daher nur morgens von Buchhof nach Insterburg fahren und dann am Abend bis dahin zurück kommen. Oft trifft der Abendzug erst morgens um 4-5 Uhr ein. Sonst ist es hier ruhig, denn selten hören wir ein Flugzeug. Heute fährt der Waldfriedener Treck von Mohrungen nach Waldfrieden ab (Anm. Dreschkommando), aber die Frauen und Kinder bleiben dort.“
Am 12. Januar, also zwei Tage nach dem Brief meiner Mutter, beginnt die sowjetische Winteroffensive mit aller Macht und damit der Countdown. Die deutschen Linien, die ja nur circa 50 km von uns entfernt sind, werden durchbrochen. Das ganze Ausmaß erfahren wir natürlich nicht. Unsere Wagen sind zwar bereit, doch da das Nachbardorf keinen Räumungsbefehl erhält, muss der Angriff unserer Meinung nach gestoppt worden sein. Wir ahnen nicht, dass es überhaupt keinen Räumungsbefehl geben wird.
Am 16. Januar will Hannelein Hüber uns noch von Elbing aus besuchen kommen und mir bei der Gelegenheit den Damenhut bringen, den sie mir auf ihr Drängen hin aus zwei Herrenhüten meines Vaters hat machen lassen. Ein Damenhut für eine Sechszehnjährige, und das in dieser Situation! Zum Glück wird sie in Insterburg von Soldaten auf die gefährliche Lage aufmerksam gemacht und zum Umkehren bewogen.
18. Januar: Kanonendonner in der Ferne, doch „Business as usual“. Zu unserer großen Überraschung bekommen wir eine Einladung zu einer abendlichen Filmvorführung im Feldlazarett des Moorbads Waldfrieden. Das ist also die allererste Kontaktaufnahme, und natürlich werde ich hingehen, aber nicht allein, sondern in Begleitung des deutschen Dienstmädchens Frieda und der „Milchschmeckerin“, einer jungen Frau, die sich im Auftrag der Insterburger Molkereigenossenschaft gerade auf unserem Hof befindet, um routinemäßig die Milcherzeugnisse jeder einzelnen Kuh in Bezug auf Menge und Fettgehalt zu überprüfen. Und das alles einen Tag vor unserer Flucht, mit dem Russen schon praktisch vor unserer Tür! Erstaunlich: Die Verwundeten zeigen sich unbesorgt. Wir bemerken keinerlei Aufbruchstimmung.
18./19. Januar: Nachts erhält mein Stiefvater die Order, sich in Aulenbach beim „Volkssturm“ zu melden. (Der Volkssturm ist Mitte 1944 aufgestellt worden und besteht im wesentlichen aus Militäruntauglichen zwischen 16 und 60 Jahren. Die ersten Einheiten - in Zivilkleidung und ohne schwere Waffenausrüstung - sind bereits im Oktober 1944 bei den Kämpfen um Goldap eingesetzt (verheizt?) worden.) Ohne meinen Stiefvater wird die Situation für uns kritisch. Auch die „Milchschmeckerin“, die bei mir im Zimmer schläft, macht sich große Sorgen um ihr weiteres Schicksal. Da, am frühen Morgen des 19. Januars kommt der erlösende Telefonanruf: Mein Stiefvater erhält die Erlaubnis, nach Hause zu kommen! Angeblich konnte er den Volkssturmführer davon überzeugen, ihn nach Waldfrieden zurückkehren zu lassen, um die Flucht einzuleiten. (Einem Bericht von Ernst Krüger aus Ernstwalde ist zu entnehmen, dass andere Volkssturmmänner den Befehl erhielten, in Stellung zu gehen. Ohne direkten Feindkontakt harrten sie dort aus, bis zufällig ein deutscher Panzerkommandant auf sie stieß und sie aufforderte, schleunigst zu verschwinden, einzeln, jede Deckung nutzend, da sie bereits vom Feind umgangen worden waren.)
19. Januar: Der Vormittag verläuft ruhig. Kanonendonner in der Ferne, doch wir sind fest davon überzeugt, dass die tapfere deutsche Wehmacht den Russen schon zurückdrängen wird. Also Routinearbeit: Die „Milchschmeckerin“ wird mehrere Dörfer weiter zu ihrem nächsten Arbeitsplatz mit Herdbuchvieh gebracht, meine Mutter backt Brot. Als ich nach dem Mittagessen etwas aus dem oberen Stockwerk holen will und rein zufällig aus dem Fenster schaue, sehe ich zu meiner Verwunderung Soldaten hinter unserer Scheune an dem Zufluss der Droje entlanglaufen. Was machen die auf unserem Land? Da gibt es doch gar keinen Weg! Wie der Blitz bin ich bei ihnen und frage einen, was er hier wolle.
Er: „Der Russe ist durchgebrochen!“ Ich: „Dann müssen wir ja gleich weg!“ Er: „Ihr kommt nicht mehr weg! Der Russe ist schon in Aulenbach!“ (Anm. 5 km Luftlinie)
Der Soldat läuft weiter, ich ins Haus. Mein Stiefvater starrt mich ungläubig an: Der Russe in Aulenbach? Das kann nicht sein! Es hat doch gar keinen Räumungsbefehl gegeben! Erst als ich ihn auf die Treppe vors Haus zerre und er die Soldaten selber sieht, begreift er das Unfassbare. Nun spielt sich alles mit einer Geschwindigkeit ab, als wäre es hundertmal eingeübt worden: Die Franzosen spannen die Pferde vor die drei vorbereiteten Planwagen und binden die überzähligen - außer einer Stute, die gerade gefohlt hat - hinten an, wir werfen die gepackten Koffer, einige Federbetten und ein paar Sachen aus dem Kleiderschrank hinauf, ebenfalls, was wir an Lebensmitteln auf die Schnelle greifen können, wie die noch warmen Brote auf dem Küchentisch - ich packe meinen Dackel Lumpi und, kaum aufgestiegen, ziehen die Pferde schon an. Die restlichen Haustiere bleiben zurück: angebunden oder in ihren Boxen eingesperrt.
Im vorderen Wagen sitzen meine Eltern und ich, in den beiden nachfolgenden fünf unserer französischen Kriegsgefangenen und die zwei Weißrussinnen, die überraschenderweise mit uns westwärts ziehen. Der 6. Franzose war dem verzweifelten Hilferuf unserer Nachbarn Burba (Mutter mit zwei Töchtern) gefolgt, deren polnischer Kriegsgefangener sich abgesetzt hatte. Unser Dienstmädchen Frieda verspricht sich mehr davon, allein auf die Flucht zu gehen (und denkt wohl an ein Militärfahrzeug des Feldlazaretts). Ein Blick zurück? Wohl nur, um zu sehen, ob der Russe schon hinter uns ist. Die Devise lautet:
- V O R W Ä R T S !
Edeltraut Tauchmann Bischweier
Februar 2021