Herforder Chronik (1910)/305
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Herforder Chronik (1910) | |
| <<<Vorherige Seite [304] |
Nächste Seite>>> [306] |
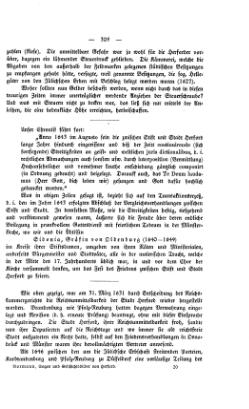 | |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: korrigiert | |
| Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
| |
zahlen (Rose). Die unmittelbare Gefahr war ja wohl für die Herforder vorüber, dagegen ein lähmender Steuerdruck geblieben. Die Kämmerei, welche die Abgaben von den außerhalb der Feldmarken gelegenen städtischen Besitzungen zu empfangen gehabt hätte, versagte, weil genannte Besitzungen, die sog. Hellegüter von den Jülichschen Erben mit Beschlag belegt worden waren (1627).
Woher sollten nun Gelder beschafft werden, wenn nicht durch das in diesen traurigen Zeiten immer unerträglicher werdende Anziehen der Steuerschraube? Und was mit Steuern nicht zu decken war, das ließ sich nur mittels der Anleihen, die eine bedenkliche Höhe erreichten, herbeischaffen.
Unser Chronist fährt fort:
„Anno 1643 im Augusto sein die zwischen Stift und Stadt Herford lange Jahre hindurch eingerissene und biß der Zeitt continuirnde (sich fortsetzende) Streitigkeiten an geist- und weltlichen juris dictionalibus, d. i. rechtlichen Abmachungen auch sonsten usw. durch interposition (Vermittlung) Hochansehnlicher und vornehmer Leuthe entschiedung gäntzlich componirt (in Ordnung gebracht) und beigelegt. Darauff auch, das Te Deum laudamus (Herr Gott, dich loben wir) gesungen und Gott dafür hochlich gedancket worden.“
Was in obigen Zeilen gesagt ist, bezieht sich auf den Transaktionsrezeß, d. i. den im Jahre 1643 erfolgten Abschluß der Vergleichsverhandlungen zwischen Stift und Stadt. In demselben Maße, wie die Streitigkeiten heftig, tiefgehend und verstimmend gewesen waren, äußerte sich die Freude über deren endliche Beilegung in prunkvollem Gottesdienst mit feierlichem Tedeum in der Münsterkirche, wo wir uns die Äbtissin
Sidonia, Gräfin von Oldenburg (1640-1649)
im Kreise ihrer Stiftsdamen, umgeben von ihren Räten und Ministerialen, anderseits Bürgermeister und Stadtväter, alle in der malerischen Tracht, welche in der Mitte des 17. Jahrhunderts üblich war, in und vor dem Chor der Kirche versammelt denken, um das Fest des Friedens zwischen Stift und Stadt Herford zu feiern.
Wie oben gezeigt, war am 31. März 1631 durch Entscheidung des Reichskammergerichts die Reichsunmittelbarkeit der Stadt Herford wieder hergestellt worden. Brandenburg wie Pfalz-Neuburg hatten dagegen Verwahrung eingelegt und Revision (d. h. erneute Prüfung) beantragt, ohne mit dieser Einsprache durchzudringen. Die Stadt Herford, ihrer Reichsunmittelbarkeit froh, sandte nun ihre Deputierten auf die Reichstage und wo immer sie als reichsfreie Stadt aufzutreten ein Recht hatte, selbst auf den Friedensverhandlungen in Osnabrück und Münster waren ihre bevollmächtigten Vertreter anwesend.
Als 1646 zwischen den um die Jülichsche Erbschaft streitenden Parteien, Kurbrandenburg und Pfalz-Neuburg zu Düsseldorf eine vorläufige Teilung des